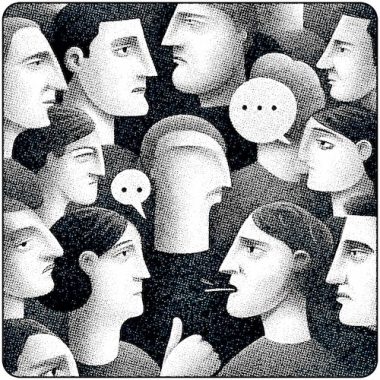Ausgabe #160 | 26. Januar 2023
Nicht mit dir
Nicht alle jungen Menschen sind, um in der Sprache der BILD zu bleiben, „Klima-Chaoten“.
Die wenigsten kleben sich auf der Straße fest, und auch Fridays for Future konnte nie mehr als ein Viertel ihrer Generation mobilisieren.
Das ist zwar, weiß der Soziologe, ein durchaus beachtlicher Erfolg, aber Fakt bleibt:
„Die“ Jugend gibt es auch bei Fragen des Kilmaschutzes und der Nachhaltigkeit nicht.
So wie es auch „die Erwachsenen“ nicht gibt.
Für all jene, die sich aktiv mit politischer Teilhabe beschäftigen, ist das nicht neu, zugleich aber immer wieder eine neue Herausforderung.
Denn in jeder Generation gibt es Milieus, die relativ leicht für Beteiligungsangebote zu gewinnen sind. Und es gibt andere, die nur selten und mit großem Aufwand und/oder unkonventionellen Maßnahmen angesprochen werden können.
Doch Milieus sind keine Menschen. Menschen aber sind unterschiedlich. Entsprechend schwierig ist es, allgemein Migrant*innen, Prekäre, Alleinerziehende, Menschen mit formell niedriger Bildung, Jugendliche und andere Gruppen als „beteiligungsfern“ zu lokalisieren.
Das ist nicht ganz falsch, in der Praxis aber auch oft nicht wirklich hilfreich.
Das macht eine neue Studie interessant, die im Auftrag des Umweltbundesamtes untersucht hat, wie Beteiligungsangebote für junge Menschen gestaltet werden sollten.
Im Fokus stand das Thema „nachhaltiger Konsum“, aber die Ergebnisse der Studie erheben einen gewissen universellen Anspruch.
Darin steht viel Kluges, aber auch gefährlicher Unsinn. Es mag daran liegen, dass die Autor*innen einem „Institut für Verbraucherpolitk“ angehören und nicht wirklich praktische Beteiligungserfahrung aufweisen.
Denn die Empirie der Studie ist solide, die Handlungsempfehlungen sind in Teilen etwas tollkühn geraten.
Betrachten wir es an einem Beispiel.
Lernen wir Jana kennen. Jana ist 15, Veganerin, Klassensprecherin, Klimaaktivistin und in der Schülervertretung aktiv.
Ihr Freund Alex ist gerade 16 geworden, engagiert sich in der freiwilligen Feuerwehr, aber nicht politisch. Hin und wieder lässt er sich von Jana zu einer Fridays-Demo mitschleppen.
Jana hat über Tik-Tok eine Einladung zu einem Beteiligungsprozess ihrer Schule bekommen: Es soll darum gehen, ob und wie die Schulkantine in Zukunft klimabewussteres Essen anbieten kann.
Sie überzeugt Alex, mit ihr gemeinsam hinzugehen. Und sie schleppt auch gleich noch ihren 14-jährigen Bruder mit. Weil der Angst um seine Currywurst hat und befürchtet, in Zukunft nur noch Grünzeug vorgesetzt zu bekommen.
Alle drei dürfen dort zunächst einmal einen Fragebogen ausfüllen.
Danach gibt es Feedback: Vorgesehen sind zwei unterschiedliche Beteiligungsangebote: Gruppe A und Gruppe K.
Jana wird in Gruppe A einsortiert, Alex in Gruppe K.
Janas Bruder? Wird nach Hause geschickt.
Die beiden Gruppen begegnen sich im Beteiligungsprozess nie wieder – und sie behandeln das gleiche Thema auf unterschiedliche Art.
Alex wird zu mehreren Treffen eingeladen, alles ist perfekt vorbereitet, Informationen gut zusammengestellt und top präsentiert. Die Moderation ist zugewandt.
Die Ergebnisse werden von ihr zusammengefasst und am Ende wird erläutert, dass die Schulleitung sie bei ihrer Entscheidung berücksichtigen wird. Abschließend gibt es für alle Teilnehmenden ein Zertifikat für ihren Lebenslauf.
Ganz anders erlebt Jana ihren Prozess.
Es gibt kaum Vorgaben, die Informationen werden gemeinsam selbst beschafft, jede*r bekommt einen eigenen mehrmals wechselnden Verantwortungsbereich.
Aktionen zum Beispiel in der großen Pause werden unterstützt, methodische Weiterbildungen gehören zum Prozess. Am Ende steht ein öffentlicher Forderungskatalog an die Schulleitung.
Klingt bis dahin erst einmal alles gut.
Lassen wir bewusst außer Acht, wie aus beiden Prozessen nachher ein konsolidiertes Ergebnis entstehen soll.
Werfen wir dagegen den Blick auf das, was tatsächlich geschehen ist: Die zielgruppenangepassten Angebote haben funktioniert.
Warum?
Weil sie das Gegenteil von Breiter Beteiligung waren.
Sie haben bestimmten Gruppen exakt das geboten, was sie motivierte. Und sie haben Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt, weil sie eine gewisse Homogenität in der Gruppe erzeugt haben.
Gruppe A steht übrigens für „Jugendliche Aktivisten“ und Gruppe K für „Jugendliche Kooperative“.
Und ja, sowohl die Einteilung als auch die jeweilen Prozesse und Formate basieren auf den Handlungsempfehlungen der erwähnten Studie.
Die Empfehlungen können Beteiliger*innen das Leben erleichtern.
Sie sind aber auch gefährlich. Weil sie das „breit“ in Breite Beteiligung nicht als „breit“, sondern als „viel“ definieren.
Und genau das ist das Problem.
Denn vermeintlich zielgruppenoptimierte Beteiligung wird optimaler, je schmaler die Bandbreite in der Zielgruppe ist.
Das kann durchaus in bestimmten Situationen – auch innerhalb von Prozessen ¬– sinnvoll sein. Grundsätzlich ist der Anspruch von Beteiligung jedoch
- Menschen über soziale Blasen hinweg miteinander in den Dialog zu bringen und
- Menschen zu beteiligen, die sich ansonsten nicht oder nicht wirksam einbringen.
Die Idee, nur die „Aktiven“ und „Kooperativen“ zu beteiligen, und jene, die weder das eine noch das andere Merkmal zugeschrieben bekommen haben, gar nicht, ist so ziemlich genau das Gegenteil von Breiter Beteiligung, selbst wenn sie auf diese Weise viele erreichen würde.
Es geht in Beteiligungsprozessen nicht darum, viele zu beteiligen, sondern die Richtigen. Und das können oft eben genau die Nichtkooperativen und Nichtaktivistischen sein.
Die sind natürlich nicht einfach zu gewinnen. Das ist anspruchsvoll, aber nicht unmöglich.
Wie das geht, das schauen wir uns in der kommenden Woche an.
Und danach betrachten wir, was wir tun, wenn uns das gelungen ist.
Dann wird es nämlich so richtig spannend …