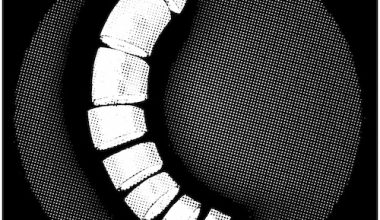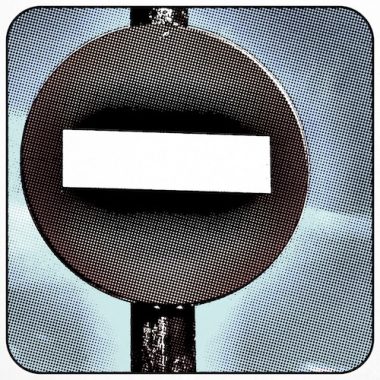Ausgabe #258 | 12. Dezember 2024
Exklusive Beteiligung
Die Mutter des kleinen Enzo war Bäuerin, sein Vater Schlosser. In der Emilia Romagna war das Leben zu Beginn des 20. Jahrhundert hart und entbehrungsreich.
Doch der kleine Enzo hatte Flausen im Kopf. Opernsänger wollte er werden. Oder Journalist. Oder Rennfahrer.
Stattdessen musste er die Hauptschule nach der dritten Klasse verlassen und im väterlichen Betrieb arbeiten.
Aber seine Zähigkeit und sein Erfindungsreichtum ebneten ihm letztlich doch den Weg zum Erfolg. Er wurde Rennfahrer für Alfa Romeo. Und ein besonders erfolgreicher noch dazu.
Letztlich gelang es Enzo sogar, seinen eigenen Rennstall aufzubauen, den er nach seinem Familiennamen benannte: Ferrari.
Bis heute zählen Ferraris zu den teuersten und exklusivsten Autos der Welt. Ein Gerücht besagt, die Marke sei so exklusiv, dass man zwei Bürgen brauche, um überhaupt einen Ferrari kaufen zu dürfen.
Das stimmt nicht.
Allerdings gibt es ein umfassendes Regelwerk, das man als Ferrari-Kunde beachten muss, um Kunde bleiben zu dürfen.
Wer illegale Straßenrennen fährt, sein Auto in einer fremden Werkstatt warten lässt, ihn in Eigenregie umbaut oder binnen eines Jahres weiterverkauft, fliegt aus der Kundenkartei und kann nie wieder ein Neufahrzeug erwerben.
Das Regelwerk und natürlich die Preispolitik sollen sicherstellen, dass die Marke vor allem eins bleibt: exklusiv.
Exklusivität ist eine der stärksten Marketing-Strategien. Dass viele andere nicht dabei sein dürfen, macht ein Produkt oder eine Dienstleistung, ein Hotel oder eine Mitgliedschaft attraktiv und erstrebenswert.
Ganz anders sieht es in der politischen Teilhabe aus. Dort sorgt Exklusivität selten für Begeisterung – eher für Frust.
Und doch gibt es sie. Ganz besonders im Bereich der Bürgerbeteiligung.
Selten ist sie beabsichtigt oder bewusst. Zum Beispiel bei gelosten Bürgerräten. Dort ist sie manchmal sogar Teil der Rekrutierungsstrategie.
„Sie wurden ausgewählt“, ist immer wieder in Einladungen an geloste Teilnehmer*innen zu lesen. Da funktioniert das Ferrari-Konzept manchmal sogar.
Was bleibt, ist die Herausforderung der übergroßen Masse der Nichtausgewählten den Prozess als Bürgerbeteiligung zu kommunizieren.
Denn das ist er ja nicht. Nicht für die Unbeteiligten.
Nun hat das Format seinen Sinn. Auf Bundesebene eine offene Betroffenenbeteiligung zu organisieren, scheitert schon an der logistischen Herausforderung. Gut organisierte und gut kommunikativ begleitete Bürgerräte, deren Ergebnisse dann auch öffentlich reflektiert werden, können eine wirksame Form partizipativer Politikberatung sein.
Beteiligung sind sie nur für den exklusiven Kreis der Beteiligten. Solange die politisch Verantwortlichen danach nicht glauben oder erzählen, sie hätten „die“ Bürger*innen beteiligt, passt das. Exklusivität ist hier Teil des Konzeptes.
An anderer Stelle in der Beteiligung heißt das Konzept oft nicht Exklusivität.
Die Realität allerdings schon.
Vor einigen Monaten lud eine norddeutsche Gemeinde zu einem Infonachmittag ein. Ein Beteiligungsprozess zur Schlossplatzgestaltung sollte vorgestellt und um Teilnahme geworben werden. Die Veranstaltung fand im Ratssaal des historischen Rathauses statt.
Mit PowerPoint-Präsentation der Stadtplaner. 72 Folien. Schriftgröße 12 Punkt. Im neuen Corporate Design der Stadt. Dunkelgraue Schrift auf hellblauem Grund.
Termin: an einem Donnerstagnachmittag um 15:00 Uhr.
Die Einladung begann mit dem wunderbaren Satz: „Vor dem Hintergrund der langfristigen Stadtentwicklung insbesondere im Bereich historische Mitte haben sich einige planerische Optionen ergeben …“
Die geplante Beteiligung sollte breit sein.
Und wurde es nicht. Zumindest nicht an diesem Tag.
26 Prozent Menschen mit migrantischem Hintergrund leben in der Stadt. Anwesend war keiner. Auch keine Menschen unter 40. Und so gut wie keine Berufstätigen.
Für die überwiegend Älteren waren die Folien kaum entzifferbar. Ein Mensch im Rollstuhl musste von vier anderen in einer riskanten Operation eine alte Holztreppe hochgewuchtet werden. Denn einen Fahrstuhl gab es im historischen Gebäude nicht.
Um gerecht zu sein: Der Beteiligungsprozess, den die Kommune sich ausgedacht hatte, war methodisch sauber, durchaus auf Wirksamkeit ausgelegt.
Doch schon die Einladung und der Auftakt machten die Beteiligung hochgradig exklusiv.
Jüngere, Berufstätige, Menschen mit körperlichen, geistigen, sprachlichen Handicaps – für sie alle war die Beteiligung nicht wirklich zugänglich.
Der irische Schriftsteller George Bernard Shaw schrieb einmal: „Das größte Problem in der Kommunikation ist die Illusion, sie hätte stattgefunden.“
Das gilt so auch für eine besondere Form von Kommunikation: die Bürgerbeteiligung. Erstaunlich oft wird in Deutschland von Beteiligung gesprochen, die aber tatsächlich nicht stattfindet.
Das ist selten beabsichtigt, oft wirklich ein Missverständnis. Häufig gibt es Veranstaltungen in deutschen Kommunen, bei denen über geplante Vorhaben informiert wird.
Das ist gut. Das fördert Transparenz.
Bürgerbeteiligung ist es nicht.
Denn die wäre Dialog mit Wirkungsanspruch. Doch die Wirkung der Teilnehmenden ist im Konzept nicht vorgesehen.
Gleiches gilt für Umfragen und Konsultationen. Nur selten ist ein erfahrbarer Wirkungsanspruch damit verknüpft, meist nicht einmal Dialog.
Für all diese Maßnahmen kann es gute Gründe geben. Nur Beteiligung sind sie nicht. Verstehen wir sie aber als solche, verstehen wir nicht, was in Beteiligung passiert – und warum wir echte Beteiligung brauchen.
Dazu kommt, dass Beteiligung, ob Vorstufe oder echter dialogischer Prozess mit Wirkungsanspruch, immer nur für jene stattfindet, die wirklich dabei sein können.
Und das ist fast immer nur eine kleine Minderheit der potenziell Betroffenen. Häufig sind ganze Gruppen oder Milieus nicht wirklich präsent.
Mit losbasierter Auswahl versucht man bei Formaten wie Bürgerräten oder Planungszellen, dieses Manko zu beheben. Doch es bleibt am Ende die Herausforderung und das Wissen, dass auch hier das Beteiligungsangebot regelmäßig nur einen Bruchteil der Betroffenen erreicht.
Das ist kein „Fehler“, aber eine Falle, die regelmäßig zuschnappt, wenn politisch Verantwortliche sagen und/oder glauben, sie hätten doch „die Bürger*innen“ beteiligt.
Daraus die Legitimation für ein Vorhaben ziehen zu wollen, ist problematisch. Zu erwarten, dass es zu einer breiten Akzeptanz führt, ist zumindest optimistisch.
Gute Beteiligung muss auf Wirkung ausgerichtet sein. Denn nur wenn die Beteiligung eines Teils der Betroffenen den Sinn hat, Veränderungsimpulse zu generieren, erfüllt sie ihren Zweck.
Wenn solche Veränderungen nicht gewünscht oder vorgesehen sind, wenn sie maximal als nötiges Nachgeben oder Kollateralschaden verstanden werden, kann man die Beteiligung auch gleich bleiben lassen.
Soll die Beteiligung hingegen gut sein, und wissen wir zugleich, dass wir immer nur einen ganz kleinen Teil der Betroffenen beteiligen, dann sollten wir zumindest darauf achten, dass die Beteiligung nicht exklusiv wird.
Und das heißt eben auch: Genau jene Gruppen in den Prozess zu holen, die gerne übersehen werden.
Dazu braucht es gezielte Ansprache. Vor allem aber braucht es Prozesse, die darauf zugeschnitten sind, diesen Gruppen Wirksamkeit zu ermöglichen.
Es reicht nicht, Wirkungsanspruch für den gesamten Prozess zu organisieren. Dieser Anspruch muss für jede einzelne beteiligte Person eingelöst werden.
Und das ganz besonders für jene Gruppen, die nicht ohnehin schon in Politik und Gesellschaft eine hohe Wirksamkeit haben.
Es ist genau jene Inklusivität, die aus beliebiger Beteiligung gute Beteiligung macht.
Dabei geht es nicht nur um die Teilnehmendenrekrutierung. Sie ist der erste Schritt in der Umsetzung, aber der letzte Schritt in der Planung.
Zuerst kommt der Plan für einen inklusiven Prozess. Für jeden einzelnen Prozessschritt – von der Aufbereitung der Informationen über die Gestaltung jedes einzelnen Formats bis zur gemeinsamen Konsolidierung der Ergebnisse.
Wie das gelingt? Die erfolgreichste Methode ist bekannt: Die Planung nicht für, sondern mit Akteuren jener Gruppen vornehmen, die auf Inklusivität besonders angewiesen sind. Ob es um Barrierefreiheit, leichte Sprache, kulturelle Prägung oder Fremdsprachen geht:
Was es braucht, wissen jene am besten, die von den vielen ausschließenden Barrieren in unserer Gesellschaft am stärksten betroffen sind.
Da sollte zumindest unsere Beteiligung inklusiv sein.
Denn das ist kein Add-on in der Beteiligung – sondern ihr Wesen.