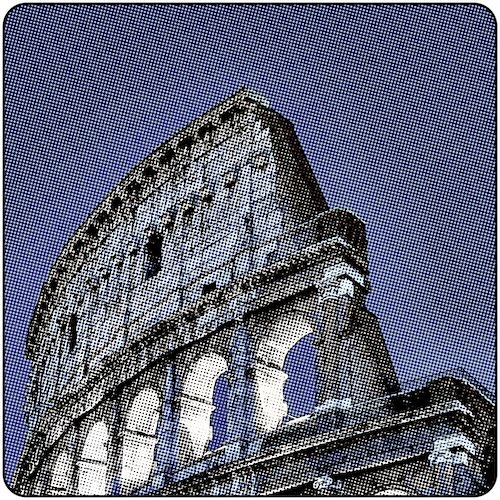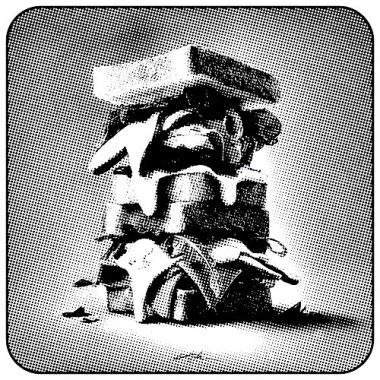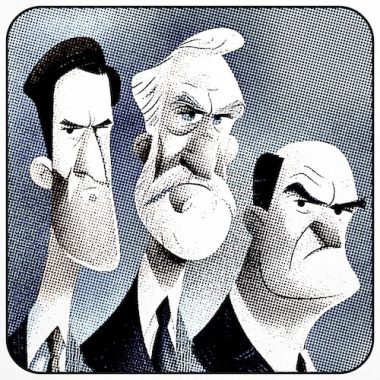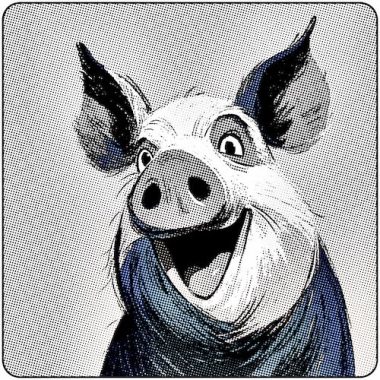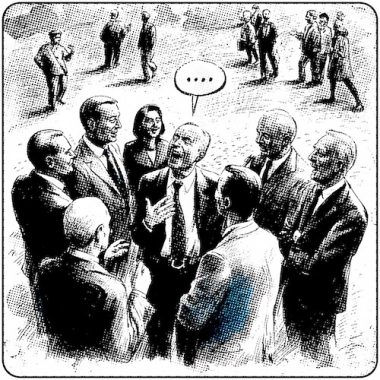Ausgabe #276 | 17. April 2025
Tod in der Arena
Wir kennen die Szene aus unzähligen Filmen.
Zwei schwer gerüstete Gladiatoren kämpfen in der römischen Arena auf Leben und Tod.
Einer der beiden stürzt schließlich aus zahlreichen Wunden blutend in den Sand. Er liegt hilflos am Boden. Sein Gegner blickt auf zu den Zuschauer*innen.
Die tobende Menge senkt die Daumen, ebenso der Imperator in seiner Loge. Der Sieger rammt dem Unterlegenen das Schwert in den Leib.
Der Daumen nach unten bedeutete im antiken Rom den Tod in der Arena. Das ist Allgemeinwissen.
Und höchstwahrscheinlich ziemlicher Quatsch.
Tatsächlich ist weder überliefert, dass Daumen nach unten für „Tod“ stand, noch Daumen nach oben für „Leben“.
Die Sache mit dem Daumen ist wohl eher eine neuzeitliche Legende.
Historiker gehen heute überwiegend davon aus, dass – sofern überhaupt praktiziert, die Gesten ganz anders zu deuten waren.
Vermutlich bedeutete eine ruhig ausgestreckte Faust mit aufliegendem Daumen „Leben“. Der aufrecht gestreckte Daumen, vermutlich mit heftiger Bewegung in Richtung Kehle, genau das Gegenteil: Tod.
Dieselbe Geste kann also völlig unterschiedlich gelesen werden.
Tod oder Leben, das sind schon maximal unterschiedliche Interpretationen.
Das gibt es auch heute noch bei Gesten in unterschiedlichen Kulturen.
Auch bei der Sache mit dem Daumen. Für uns steht eine ausgestreckte Faust mit dem Daumen nach oben dafür, dass alles in Ordnung ist. In vielen Ländern in Südamerika (aber auch in Griechenland, Nahost, Russland, Sardinien und Westafrika) bedeutet diese Geste das Gegenteil. Es wird als „Leck mich!“ verstanden.
Ähnliches gilt für Begriffe und Bezeichnungen. Und das manchmal sogar innerhalb derselben Gesellschaft.
Bürgerbeteiligung ist so ein Begriff.
Im Berlin Institut haben wir kürzlich sämtliche Drucksachen, Protokolle und Dokumente aller deutschen Landtage des vergangenen Jahres durchsucht.
Es gab 885 Treffer. Davon knapp 600 Mal in Anträgen, Anfragen oder Beiträgen von Abgeordneten.
Wie aber haben die Abgeordneten den Begriff verwendet, was meinten sie damit?
Das Ergebnis überraschte:
Nur in etwa einem Fünftel aller Fälle war damit tatsächlich das gemeint, was wir unter Bürgerbeteiligung verstehen: Dialoge, Prozesse mit Bürgerinnen und Bürgern zu konkreten Themen auf kommunaler, regionaler oder überregionaler Ebene.
Über die Hälfte der Abgeordneten verwechselte Bürgerbeteiligung mit anderen Formaten. Dazu zählten Verbändeanhörungen in Gesetzgebungsprozessen, schlichte Informationsangebote, Meinungsumfragen oder unverbindliche Online-Konsultationen.
Fast ein Viertel der Texte sprach von Bürgerbeteiligung und meinte finanzielle Beteiligung. Meist ging es um Investitionsmöglichkeiten in Windparks. Doch es wurde auch privater Waldbesitz als Bürgerbeteiligung definiert. In anderen Fällen meinte Bürgerbeteiligung schlicht die Erhebung von Kita-Gebühren.
Die restlichen Prozentpunkte verteilten sich auf das Verständnis von Petitionen, Landtagsbesuchen oder schlicht die Teilnahme an Wahlen als Bürgerbeteiligung.
Es geht also wild durcheinander in deutschen Parlamenten, was das Verständnis bereits elementarer Begriffe der politischen Teilhabe betrifft.
Auch wenn man die ein oder andere rhetorische Stilblüte herausrechnet, die sich manch ein Abgeordneter bewusst leistete, so deckt sich diese empirische Erhebung mit Erkenntnissen, die ich selbst aus unzähligen Beratungsgespräche mit Parlamentarier*innen gewinnen konnte.
Die Unkenntnis über Strukturen, Prozesse und Potentiale von dialogischer Bürgerbeteiligung ist hoch.
Das ist verständlich.
Denn das „Kerngeschäft“ von gewählten Politiker*innen sind eben: Wahlen. Und ist man erst einmal gewählt, ist die Fülle an Themen, die es zu durchdringen gilt, nahezu unendlich.
Fachfrau oder Fachmann für Bürgerbeteiligung zu sein, ist in deutschen Parlamenten schon strukturell kein Karrieremodell.
Die Unkenntnis im Bereich Bürgerbeteiligung ist längst nicht immer böser Wille oder Bürgerverachtung. Doch das fehlende Verständnis ist ein Problem.
Wenn Bürgerbeteiligung sich qualitativ und quantitativ weiterentwickeln soll, braucht es dazu Rahmenbedingungen und Ressourcen. Genau über die aber wird in Parlamenten entschieden.
Dazu braucht es Strukturen.
Die Bertelsmann Stiftung hat kürzlich die Etablierung eines Bundestagsausschusses für Demokratiepolitik vorgeschlagen.
Auch Staatsminister*innen (wie sehr erfolgreich in Baden-Württemberg) oder Beauftragte können Impulse setzen. Ebenso wie Stabsstellen in Landesregierungen oder Referate in Parlamentsverwaltungen.
Die Pfade sind unterschiedlich, die Hebel immer ähnlich: Strukturen bauen Kompetenzen auf – und Parteien werden so angehalten, dies ebenfalls zu tun.
Das geht weder schnell, noch wird es in allen Parteien Wirkung zeigen. Wer wie eine AfD bei Bürgerräten eine „Räteherrschaft durch die Hintertür“ wittert, tut dies nicht aus mangelnder Kompetenz. Das ist strategisches Missverstehen, also schlicht: Absicht.
Um so wichtiger ist es, dass möglichst viele demokratische Politikerinnen und Politiker die Potentiale guter Bürgerbeteiligung erkennen und fördern.
Die gute Nachricht lautet: Da gibt es noch eine Menge Potential.