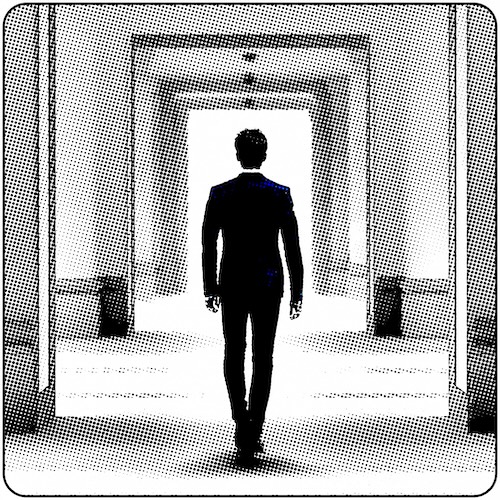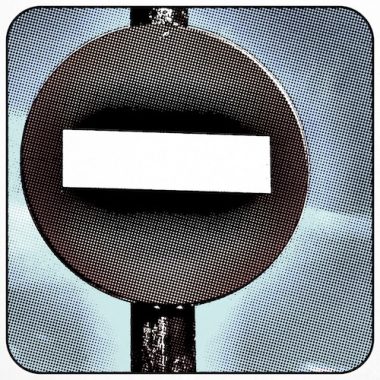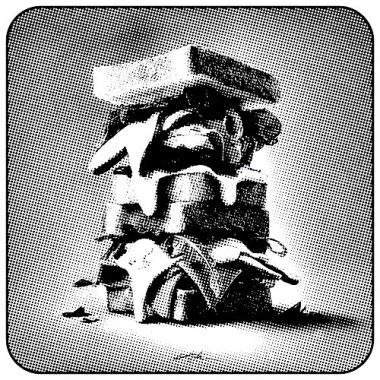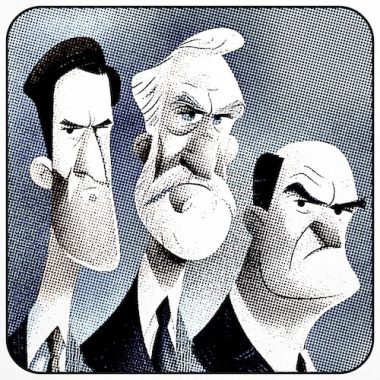Ausgabe #280 | 15. Mai 2025
Lobbyismus und Gemeinwohl
33.200 Personen stehen im Lobbyregister des Deutschen Bundestages. Das sind 45 Lobbyisten für jeden Bundestagsabgeordneten.
Von dem Betreuungsschlüssel können unsere Kitas nur träumen.
Den Abgeordneten verursacht es manchmal eher Alpträume.
Der Lobbyismus ist ein fester Bestandteil des Politikbetriebs. Er hat kein gutes Image. Aber Wirkung.
Er ist breit gefächert. Viele Lobbyisten sind für eine einzelne große Firma tätig, versuchen je nach Auftraggeber die Energiewende auszubremsen oder zu beschleunigen, Subventionen zu streichen oder auszubauen, Gesetze zu verschärfen oder zu lockern.
Ganz ähnliche Ziele haben Industrie- und Branchenverbände.
Aber auch gemeinnützige NGOs und Betroffenengruppen wie z.B. Patientenverbände mischen mit.
Manche Lobbyisten sind für handfeste Partikularinteressen unterwegs. Manche eher gemeinwohlorientiert. Je nach Perspektive gibt es „gute“ und „böse“ Lobbyisten. Doch diese Unterscheidung ist gar nicht so relevant. Viel spannender ist die Frage, welche Rolle sie in unserer Demokratie spielen. Und welche sie spielen sollten.
Zeit für eine „Transparenzerklärung“: Einer von den 33.200 bin auch ich. Lobbyist für ein oft eher schwer verkäufliches Thema im politischen Berlin: Demokratie – und demokratische Teilhabe. Und auch aus einem weiteren Grund eine ganz schlechte Berufswahl. Demokratie ist kein solventer Auftraggeber. Die Finanzwirtschaft hat ein jährliches Lobby-Budget von 42 Millionen Euro, die Energiewirtschaft rund 23 Millionen, die Auto- und Chemieindustrie ähnlich viel. Unser Budget für Demokratie-Lobbying liegt eher so bei 0,1 Prozent dieser Summe. Aber das ist nicht das Problem.
Denn wer Wirkung oder Kritik des Lobbyismus am Geld festmacht, der hat seine Rolle und sein demokratisches Potential nicht ganz verstanden.
Denn Lobbyismus ist kein Störfaktor im politischen Betrieb. Sondern elementarer Bestandteil, aber einer mit ein paar Merkwürdigkeiten.
Das fängt mit unserem Grundgesetz an: Lobbyisten kommen darin gar nicht vor. Es gibt sie, aber sie sind nicht vorgesehen. Und genau das ist das Problem.
Wir leben ein Demokratie-Design, dessen Konstruktion nicht der politischen Praxis entspricht. Und das ist nie eine gute Idee.
Die Allianz Vielfältige Demokratie hat das Modell der drei Säulen entwickelt, die gemeinsam eine Demokratie stark machen:
Zentrale Säule der Demokratie ist und bleibt die repräsentative Säule, also unsere Parlamente und Regierungen. Ihre Stärke: Entscheidungen treffen.
Flankiert wird sie von der direktdemokratischen Säule. In Deutschland eher lokal, in vielen anderen Ländern auch auf nationaler Ebene. Ob Volksbegehren, Bürgerentscheid oder unter anderem Namen: Manche Themen gehen zu viele Menschen zu viel an, um sie nur delegiert zu bearbeiten. Die Stärke dieser Säule: Maximale Legitimität der Entscheidungen.
Und dann gibt es noch die dritte, partizipative Säule. In ihr finden wir Formate der Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung, die in den vergangenen zehn Jahren ganz erheblich an Umfang und Qualität gewonnen haben. Die Stärke dieser Säule: Dialog.
Genau das ist der Kitt, der Gesellschaften zusammenhält, der Demokratie stärkt: Miteinander zu reden, statt sich in der eigenen Blase zu radikalisieren.
Beteiligung in tausend Formaten leistet, wenn sie gut gemacht ist, einen ganz entscheidenden Beitrag zum Miteinander.
Aber auch zur Qualität der Ergebnisse unserer repräsentativen Säule.
Weil der Diskurs die Meinungsbildung der Entscheider bereichert. Weil mehr Perspektiven in den Diskurs gelangen. Weil Alltagsperspektive und Partikularinteressen erkennbar und verhandelbar werden.
Und genau das braucht Demokratie. Denn es geht dabei um eine zentrale Frage: Das Gemeinwohl.
Doch was ist das? Eine gängige Definition lautet:
„Das Gemeinwohl bezeichnet das Wohl und die Interessen der Gesamtheit einer Gemeinschaft, sei es eine Nation, eine Region, eine Stadt oder eine andere soziale Gruppe.“
Einige erweitern den Gemeinwohlbegriff um zukünftige, noch ungeborene Generationen. So fokussiert sind junge Menschen, die auf Kreuzungen kleben, Streiter fürs Gemeinwohl.
Würde man in der eben erwähnten Definition: „Das Wohl und die Interessen der Gesamtheit einer Gemeinschaft, sei es eine Nation …“
die „Nation“ durch „Volk“ ersetzen, könnte auch eine seit kurzem als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei sich als gemeinwohlorientiert gerieren.
DAS Gemeinwohl ist also so einfach nicht zu ermitteln.
Zum Glück leben wir in einer Demokratie. Bei uns entscheidet nicht eine Partei oder ein Herrscher, was Gemeinwohl ist.
Bei uns ist Gemeinwohl Verhandlungssache.
Die wohl wichtigste Verhandlungssache einer Demokratie.
Und eine komplexe.
Denn all unsere Wahlverfahren, unsere Geschäftsordnungen, Gesetze und Verordnungen garantieren nicht, dass am Ende Gemeinwohl dabei herauskommt.
In Gemeinwohl steckt Gemeinschaft. Nicht ohne Grund. Gemeinwohl wird in jeder Generation, bei jedem Thema, in jeder historisch herausfordernden Situation immer wieder neu verhandelt.
Das geht nicht per Beschluss, das geht nur im Diskurs. Mit allen, die es betrifft, und das sind immer wieder unterschiedliche Gruppen.
Genau das ist es, was in Beteiligungsprozessen stattfindet.
Genau dort, wo, wie wir gesehen haben, der Dialog im Vordergrund steht.
Wo Interessen aufeinanderprallen, Werte und Haltungen.
Der ehemalige Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel war bekannt für seine präzisen, oft bösen Sprüche im politischen Betrieb. Von ihm ist das Zitat überliefert: „Die Summe von Partikularinteressen gibt nicht Gemeinwohl, sondern Chaos.“
Und er hat Recht. Partikularinteressen prägen jede Gesellschaft. Sie zu addieren führt zu nichts, sie mathematisch anders zu lösen, mit Mehrheit versus Minderheit, ist oft irgendwann nötig.
Genau dafür statten wir unsere Abgeordneten ja mit einem robusten und nicht mit einem imperativen Mandat aus. Das reicht aber nicht, um Gemeinwohl zu bestimmen.
Dazu braucht es Formate, in denen diese Partikularinteressen sichtbar werden, verstehbar werden, und so verhandelbar werden.
Das ist das, was Demokratie ausmacht.
Das ist das, was die partizipative Säule leistet.
Und nun ist der Moment, in dem wir noch einmal den eingangs geschilderten Lobbyismus betrachten. Bei dem es ja genau um diese völlig legitimem Partikularinteressen geht.
Und den wir alle im politischen Betrieb, in den drei Säulen der Demokratie bislang nicht so richtig verordnet bekommen.
Irgendwie klebt er in der Wahrnehmung vieler (auch in der Selbstwahrnehmung vieler Akteure) an der repräsentativen Säule. Irgendwie unbestellt, aber nicht unwirksam, schwer zu verstehen, schwer zu durchschauen, schwer zu legitimieren.
Weil es nicht stimmt.
Lobbyismus ist nichts anderes als ein spezifisches Format in der dritten, der dialogischen Säule der Demokratie. Da gehört er hin, das ist sein Wirkmuster und sein Potential.
Weil wir die drei Säulen der Vielfältigen Demokratie in dieser Klarheit erst vor nicht allzu langer Zeit herausgearbeitet haben, sind wir dort noch immer munter am Experimentieren.
Und denken noch zu wenig Dinge zusammen.
Dadurch verschenken wir noch viel Potential.
Wir haben teilweise schwer begründbare Vorbehalte gegenüber einzelnen Formaten.
Bei der Partizipation von Industrievertretern halten wir es für normal, dass sie mehr oder weniger direkt wirksam auf Gesetzgebungsverfahren Einfluss nehmen.
Bei Vertretern von Betroffenen wie z.B. Patientenverbänden, sind wir da zurückhaltender.
Bei unorganisierten Bürgerinnen und Bürgern halten wir das Ansinnen gar für tollkühn und unverfroren.
In der Bundespolitik geht es mit den Dialogen noch wild durcheinander. Neben unzähligen Lobbyveranstaltungen gibt es in faktisch jedem Gesetzgebungsverfahren „Verbändeanhörungen“. Dazu unzählige Vier-Augen-Gespräche mit Lobbyisten aller Art.
Was haben wir dagegen den Bürgerinnen und Bürgern zu bieten?
Hier experimentieren wir mit (bislang gerade mal 2) losbasierten Bürgerräten, die zwar in der Praxis bislang auch keinen wirklichen Einfluss haben, aber dennoch schon bei einzelnen Akteuren der repräsentativen Säule zu Panikreaktionen führen.
Wir haben schlicht kein solides Konzept für die Dialogische Säule auf nationaler Ebene. Wir beteiligen wahllos, interessengeleitet, unsystematisch, unkoordiniert und ungerecht.
Dabei wissen wir längst: Wir müssen die dritte, dialogische Säule der Demokratie weiter ausgestalten. Denn wir brauchen sie.
Gerade weil die Unsicherheit unsere Zukunft betreffend steigt, weil uns Transformationen bevorstehen, deren Ausmaß uns noch immer nicht klar ist. Transformationen, die ohne partizipative Einbindung der Betroffenen unsere Gesellschaft auseinanderreißen können.
Wir brauchen die dialogische Säule, wenn die Demokratie die Transformationen überleben soll, wenn wir sie demokratisch gestalten wollen.
Und deshalb müssen wir diese Säule klar gestalten und stabil aufsetzen. So wie wir es mit unserer repräsentativen Säule seit langem tun.
Dazu braucht es Formate mit breiterer Beteiligung, mit mehr Wirkung, mit klaren Regeln, Prozessen und mit allen Akteuren.
Die Partikularinteressen der Wirtschaft sind legitim. Die Partikularinteressen der unorganisierten und organisierten Bürgerinnen und Bürger sind es auch. Und sie dürfen, sollen, ja müssen aufeinandertreffen.
Weil eben die Gestaltung von Gemeinwohl besonders in Zeiten des Umbruchs nur so funktioniert. Beteiligung von Betroffenen. Echte Partizipation. Das ist der Schlüssel.
Aus einem Guss, mit einem Ziel: Partikularinteressen zu respektieren, aber gemeinsam Gemeinwohl zu generieren. Was wir benötigen, ist eine nationale Strategie für Beteiligung, für Dialog, für die Verhandlung von Gemeinwohl.
Entwickeln kann man eine solche Strategie in den Ministerien.
Oder in einem breiten Partizipationsprozess.
Meine Präferenz? Liegt auf der Hand …