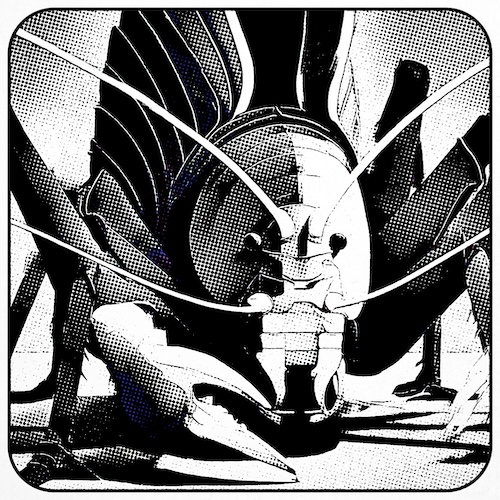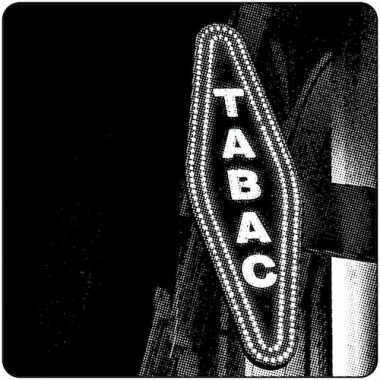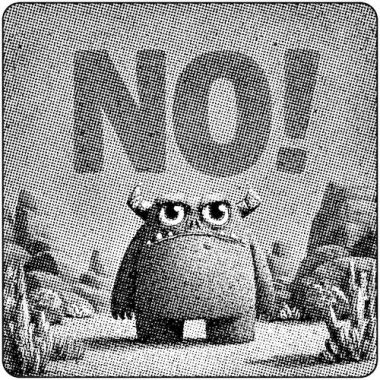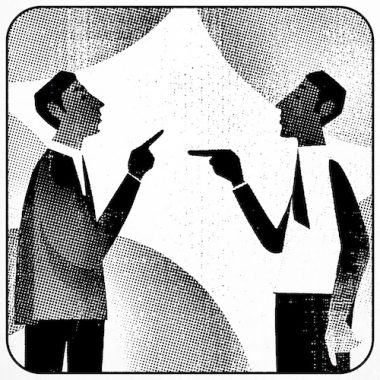Ausgabe #292 | 7. August 2025
Die Fraktion der Gliederfüßer
Demokratien entwickeln sich, indem sie dem Anspruch Teilhabe und Politik für Alle zu ermöglichen, immer wieder neu gerecht werden. Wer sind diese Alle?
Mit dieser Frage beginnt eine Initiative ihre Selbstdarstellung, die auf den ersten Blick mehr als nur ein bisschen schräg daherkommt.
Denn sie pflegt, mitten in der deutschen Hauptstadt Berlin, ein eigenes „Staatsgebiet“.
Das klingt ein wenig nach Reichsbürger-Bewegung. Doch nichts könnte den Initiatoren ferner liegen.
Die Reichsbürger-Szene leugnet die Legitimität der Bundesrepublik Deutschland und wähnt sich nach wie vor im Deutschen Reich – eben, weil sie mit der Demokratie nichts anfangen kann.
Die Menschen, um die es heute gehen soll, haben 2019 in Berlin ein Testgelände für eine weiterentwickelte Demokratie begründet.
Offiziell ist es ein Kunstprojekt, aber eines mit klarem Gesellschaftsbezug. Die Initiative will dort erproben, wie ein demokratisches Zusammenleben „Aller“ aussehen kann.
Spannend ist ihre Definition von „Alle“. Sie meinen damit, dass alle Lebewesen, die auf ihrem Grundstück leben, die gleichen Rechte und politischen Gestaltungsmöglichkeiten haben sollen.
Gemeint sind damit neben Menschen auch Pflanzen, Tiere, Pilze – ja sogar Viren und Bakterien.
Klingt etwas irre?
Wird noch besser. Verhandelt wird der Interessenausgleich in einem Parlament. Das setzt sich aber nicht aus politischen Parteien zusammen, sondern aus sieben „Obergruppen“ von Lebewesen.
Die entsprechenden Fraktionen heißen: Weichtiere und Würmer, Gliederfüßer, Gehölze und Kletterer, Kräuter, Gräser, Stauden, Pilze Moose, Flechten, Wirbeltiere, Bakterien, Einzeller, Viren und Neobiota.
Das Parlament tagt wirklich. Vertreten werden die Fraktionen durch Menschen. Zugewiesen werden ihnen die Fraktionen über einen eigenen digitalen „Wahlomat“.
Die Menschen selbst sind Freiwillige, Aktivist*innen, Nachbar*innen, Kinder oder angeworbene Passant*innen.
Das Parlament diskutiert, wie das „Staatsgebiet“ gestaltet und gepflegt werden soll, damit alle Fraktionen sich dort wohlfühlen.
Das Konzept nennt sich „Organismendemokratie“ und existiert nicht nur in Berlin. Die erste Organismendemokratie wurde 2018 in Wien gegründet. In Deutschland gibt es aktuell Initiativen in Berlin, Augsburg, Gelsenkirchen und Havixbeck.
Natürlich kann man an dem Konzept schnell Schwachpunkte finden und Kritik formulieren. Auch hier steht Stellvertreterpolitik statt unmittelbarer Partizipation der Betroffenen im Mittelpunkt, auch wird das Parlament ohne demokratische Wahl zusammengesetzt.
Beides wäre anders kaum umsetzbar – und auch nicht nötig. Die Organismendemokratie ist in dieser Form auch kein Zukunftsmodell der Demokratie, aber:
Es bringt uns zum Nachdenken. Über Nachhaltigkeit, über Gerechtigkeit, über Verantwortung, über fairen Interessenausgleich – und darüber, dass eine demokratische Mehrheitsentscheidung nicht immer automatisch die für alle Betroffenen beste Lösung sein muss.
Gute demokratische Prozesse haben das Gemeinwohl im Blick, Organismendemokratie thematisiert genau das.
Auch wenn sich die Bewegung als Kunstprojekt begreift, so hat sie ein bislang weitgehend ungenutztes Potential: Sie könnte ein Bildungsprojekt sein.
Gerade für den Einstieg in die Beschäftigung mit Demokratiethemen wäre ein schulischer Organismendemokratie-Projekttag eine wunderbare Idee. Dafür geeignet ist jedes Schulgelände. Denn alle Fraktionen gibt es überall.
Am Ende hängt die Beziehung junger Menschen zur Demokratie maßgeblich davon ab, dass sie Wirksamkeit zu den Themen erfahren, die sie persönlich unmittelbar betreffen.
Deshalb kann ein Tag Organismendemokratie an der Schule auch nur ein Auftakt sein. Als solcher aber ist er eine wunderbare Wahl.
Übrigens, auch ich habe den Wahlomat getestet. Was heraus kam? „Meine“ Fraktion sind die …
Gliederfüßer.