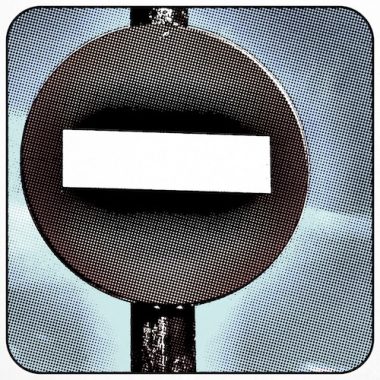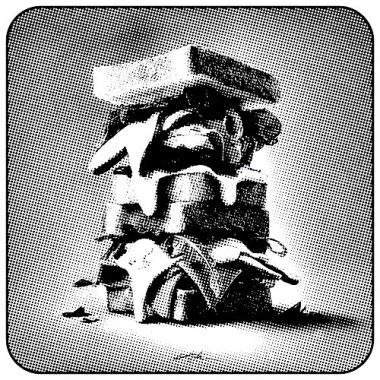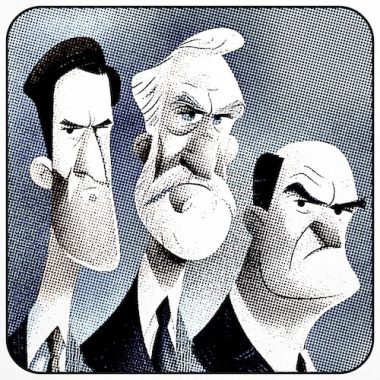Ausgabe #294 | 21. August 2025
Nieder mit der Autokorrektur!
Da helfe ich einem Freund einen ganzen Samstag beim Umzug, schleppe bei 34 Grad im Schatten Kisten, Koffer und Kartons. Und als ich abends fix und fertig auf dem Sofa liege, kommt per WhatsApp ein kurzes:
„Danke für deinen entbehrlichen Einsatz heute.“
Erst am nächsten Morgen dann die Entschuldigung:
„Sorry, sch… Autokorrektur.“
„Sollte entbehrlich heißen“
„Äh. Erheblich!!!!“
Ich weiß nicht, wer die Autokorrektur wann erfunden hat.
Vielleicht kommt sie auch direkt aus der Hölle.
Sie schafft Konflikte, wo es keine gibt. Sie schafft Verzweiflung, wo es keine braucht. Vor allem aber ist sie eine entmündigende Technologie.
Ihre Botschaft: „Ich weiß schon, was du schreiben willst, bevor du es getan hast. Du brauchst nicht mal nachzudenken. Mach einfach weiter.“
Das nervt. Und kränkt. Denn es führt mir vor, wie wenig individuell ich bin, wie durchschaubar, wie durchschnittlich. Und wie fehlerhaft.
Die Autokorrektur standardisiert unsere Kommunikation, reduziert ihre Kreativität.
Und das vor allem auf Smartphones seit einiger Zeit immer dreister. Denn noch während ich ein Wort schreibe, wird mir schon das nächste vorgeschlagen. Erstaunlich oft genau das, das ich schreiben wollte. So klicke ich mir immer öfter meine Sätze einfach so zusammen.
Was dabei rauskommt ist kommunikative Massenware.
Selbst Social Media Plattformen forcieren diese Technologie. Lese ich auf LinkedIn über einen neuen Job einer Bekannten, schlägt mir das System gleich eine Standard-Gratulation vor. Nur noch ein Klick und ich habe interagiert.
Die Qualität der zwischenmenschlichen Kommunikation wird dabei noch weiter geschliffen.
Und doch spielen wir allzu oft mit, weil es schneller und bequemer ist. Und uns das Denken erspart.
Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht über die Autokorrektur fluche. Manchmal scheint sie es regelrecht darauf abgesehen zu haben, meine Botschaften zu vermurksen.
Und doch habe ich sie noch immer nicht vollständig deaktiviert.
Genau darin besteht die Gefahr solcher Tools mit Nudging-Effekt: Sie holen uns in unserer eiligen Faulheit ab. Und lenken uns dafür nicht immer in die Richtung, in die wir wollen.
Tatsächlich ist die Autokorrektur der Gegner guter Kommunikation.
Und guter Partizipation.
Wie das?
Weil wir in Beteiligungsprozessen immer wieder eine Moderation „mit Autokorrektur“ erleben. Besonders häufig geschieht dies in Formaten der breiten Beteiligung – wenn Menschen sich einbringen, die mit der deutschen Sprache und/oder Diskursen wenig Erfahrung haben.
Wer sich nicht so ausdrücken kann, dass sein Vorschlag einfach, eingängig und druckreif ist, bekommt gerne mal „Unterstützung“ durch die Moderation.
Und die neigt dabei manchmal zu Autokorrektur.
Wenn ein Moderator oder eine Moderatorin beginnt mit „Sie wollten also sagen, dass…“, dann spielt es kaum eine Rolle, ob am Ende noch ein Fragezeichen steht.
Es ist eine Korrektur, eine Veränderung, eine Aufbereitung und damit schnell eine – auch ungewollte – Manipulation.
Dabei ist das Problem nicht (nur) eine eventuelle Verfremdung des Beitrages oder gar Vorschlages.
Es ist die Botschaft, die wir aus der digitalen Autokorrektur kennen: Du musst korrigiert werden, du brauchst Hilfe. Ich weiß besser als du, was du willst.
Botschaften, die wir in Beteiligungsprozessen nicht brauchen, nicht wollen, nicht zulassen dürfen.
Auch, wenn es gängige Praxis mancher Moderator*innen ist: Beteiligungsmoderation kennt keine Autokorrektur.
Natürlich kann es nötig und sinnvoll sein, bei Ideensammlungen zu klären, was genau gemeint ist.
Doch eben nicht per Autokorrektur durch die Moderation. Sondern als Rückversicherungsprozess unter den Beteiligten.
Deshalb präferieren wir in der Beteiligung Vorschlags- und Kreativitätsprozesse in wechselnden Kleingruppen, oder wie bei der 1-2-4-all Methode in wachsenden Gruppen.
Brainstorming im Plenum ist deshalb eher kein Beteiligungsformat. Eben aufgrund der sehr unterschiedlichen individuellen Voraussetzungen.
Diskurse in Arbeitsgruppen führen Moderator*innen weniger in Versuchung. Und wenn dann bei der Sammlung der Gruppenergebnisse nachgefragt werden muss, ist das resilienter. Weil keine Einzelpersonen korrigiert werden.
Die Moderation von Beteiligungsprozessen ist tatsächlich ein in vielen Bereichen eigenständiges Genre.
Sie bedarf spezifischer Kompetenzen und Haltungen. Im Zertifikatslehrgang Beteiligungsmanagement des Berlin Instituts für Partizipation ist der Beteiligungsmoderation deshalb ein eigenes Modul gewidmet.
Und darin ist eine der Botschaften:
Autokorrektur ausschalten.