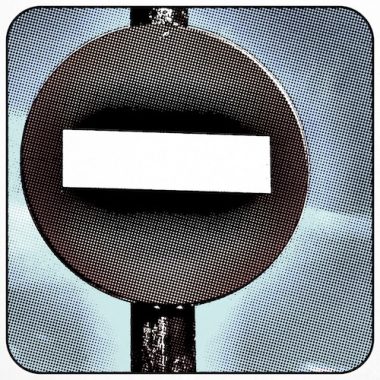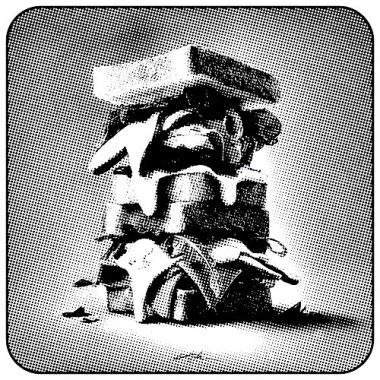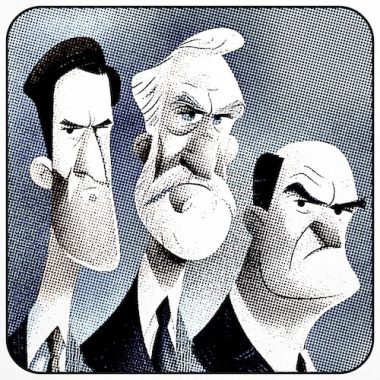Ausgabe #295 | 28. August 2025
Prävention oder Therapie?
In der Regel beschränkt sich mein Kontakt mit Medizinern auf unvermeidbare Arztbesuche. So ein klein wenig leide ich, wie viele Menschen, unter Praxis-Phobie.
Wenn ich dann doch 1:1 einem Arzt oder einer Ärztin gegenübersitze, herrscht stets ein wenig Beklemmung.
Und doch habe ich mich kürzlich in einen ganzen Raum voller Krankenhauspersonal gewagt. Geholfen hat dabei sicher meine Rolle. Diesmal nicht als Patient, sondern als Berater.
Denn unser Gesundheitswesen, vor allem das institutionelle, hat eine ähnliche Kultur, wie unsere Wirtschaft und unsere Hochschulen: Autoritär und von einem hohen Machtgefälle geprägt.
Seit einigen Jahren wird das zunehmend kritisch hinterfragt. Partizipation wird zum Thema. In der Beteiligung von Patient*innen und Betroffenenorganisationen gibt es zwischenzeitlich umfangreiche, durchaus positive Erfahrungen. Erst kürzlich habe ich dazu bei einem Parlamentarischen Abend in Berlin gesprochen.
Eine der Folgen davon: Die Einladung, in einer renommierten Klinik über die Möglichkeiten von Mitarbeiterbeteiligung zu diskutieren.
Die Debatte lief gut, bis hinauf in die Chefetage war zu spüren, dass man ernsthaft über partizipativere Strukturen nachdenken wollte. Verkrustungen, Frustrationen, Demotivation sollten so überwunden werden. Schließlich stellte ein Oberarzt eine typische Mediziner-Frage:
„Sagen sie mal, ist Beteiligung eigentlich eher Prophylaxe oder Therapie?“
Spannend.
Wir kennen Prophylaxe (in der Medizin) vor allem als Maßnahme, die eine Erkrankung vermeiden oder zumindest hinauszögern soll. Therapie dagegen behandelt Erkrankte und strebt in der Regel eine Genesung an.
Das ist natürlich sehr vereinfacht. Es mag für unsere Zwecke aber reichen – und auch die Frage des Arztes war so zu verstehen.
Die Frage war ehrlich gemeint, aber ziemlich fies. Denn wir wissen aus der medizinischen Praxis, dass Prophylaxe und Therapie sehr unterschiedliche Behandlungen und ggf. auch Medikamente einsetzen.
Regelmäßiges Zähneputzen ist Prophylaxe. Doch wenn ein Weisheitszahn Probleme verursacht, kann man das nicht wegschrubben, dann muss der Zahnarzt ran.
Wir kennen das auch aus anderen Bereichen, dort heißt Prophylaxe meist Prävention. Eine mögliche Prävention gegen Verkehrsunfälle lautet: Geschwindigkeitsbegrenzung. Eine Prävention gegen deren Folgen lautet: Gurtpflicht.
Ob beim Zahnarzt oder im Straßenverkehr: Methoden und Formate von Prävention und Therapie unterscheiden sich erheblich.
Was heißt das nun für die Beteiligung?
Ist sie eine Prävention? Gegen Konflikte, Akzeptanzprobleme, Verzögerungen, Demokratiemüdigkeit oder gar antidemokratische Entwicklungen?
Könnte man sagen.
Oder ist sie eine Therapie? Die Konflikte bearbeitet, Einvernehmen herstellt, Lösungen findet, Selbstwirksamkeit ermöglicht, Demokratie stärkt?
Könnte man sagen.
Meine Antwort bei den Medizinern:
Ja. Und …
Tatsächlich gibt es noch eine dritte Funktion, die wir aus der Medizin kennen und die auf Beteiligung zutreffen kann:
Beteiligung als Anamnese.
Anamnese ist ein zentraler Begriff der Medizin und bezeichnet das Erfragen von Beschwerden und der Krankheitsgeschichte eines Patienten oder einer Patientin. Ziel ist es, alle wichtigen Informationen über die Gesundheit des Patienten zu sammeln, die für eine Therapie notwendig sind. Anamnese ist also ein Diagnosetool.
Und genau das ist ein wesentliches, oft aber unterschätztes Element in vielen Beteiligungsprozessen: Die Ermittlung der Faktoren, die den Ist-Zustand prägen. Wer hat welche Interessen? Wer trägt welche Risiken? Wie ist ein Konflikt entstanden? Wer wie sehr objektiv oder subjektiv betroffen?
Beteiligung kann alles drei sein: Prävention, Diagnosetool oder Therapie.
Das ist die einfache Antwort.
Die anspruchsvolle Ergänzung: Aber nie alles drei zugleich.
Denn so wie sich Methoden und Prozesse in der Medizin bei Prophylaxe, Anamnese und Therapie grundsätzlich unterscheiden, so gilt das auch für soziale Prozesse.
Prävention, Diagnose und Therapie brauchen unterschiedliche Tools, Formate und Prozesse – und oft auch unterschiedliche Beteiligte.
Beteiligung kennt für alle drei Einsatzgebiete geeignete Methoden. Nur ist es wichtig, sie auch richtig einzusetzen.
Bürgerräte sind zum Beispiel ein ganz ausgezeichnetes Diagnosetool. Konflikte wegzutherapieren sollte man von ihnen aber nicht erwarten.
Therapeutisch motivierte Beteiligung für Menschen, die mit der Demokratie hadern, machen Sinn – aber nur, wenn deren Erfahrungen, Frustrationen und Vorbehalte auch von ihnen thematisiert werden können.
Bewusst ausgewählte Bürgerinnen zum Beispiel zur Klimaresilienz einer Kommune zu beteiligen, kann ein wunderbarer Auftakt in der Prävention sein – braucht aber langfristige Folgeprozesse.
Wir sehen schon an diesen drei Beispielen: Bürgerbeteiligung kann vieles sein, weil sie vielfältige Formate und Methoden kennt.
Das heißt aber auch: Wir sollten jeweils wissen, was wir tun. Eine Beteiligung mit Präventionsanspruch ist eben etwas ganz anderes, als eine partizipative Diagnose oder gar eine Konfliktlösung.
Die Faustregel Nummer eins lautet deshalb: Ein Prozess – eine Funktion.
Und wenn ein Prozess doch zwei (niemals alle drei!) der Aufgaben anfassen soll? Dann empfiehlt es sich, die Phasen klar zu definieren – und natürlich mit der Diagnose zu beginnen.
Ob danach gemeinsam eine Prävention entwickelt oder eine Therapie organisiert wird – beides ist denkbar.
Was in der Praxis aber regelmäßig zu Konflikten, Verwerfungen und Frustrationen führt: Wenn Prävention und Therapie durcheinandergewürfelt werden.
Deshalb ist es so wertvoll, jeden Beteiligungsprozess vor der Umsetzung noch einmal kurz zu checken:
Was geschieht eigentlich in den einzelnen Phasen? Ist das Diagnose? Soll es präventiv wirken? Oder geht es um „Heilung“?
Alles ist möglich – solange wir wissen, was wir da tun.