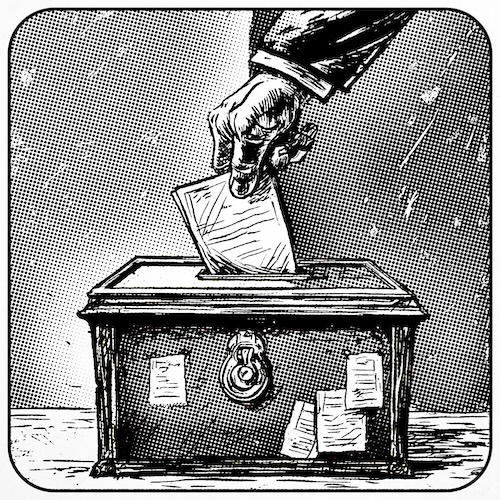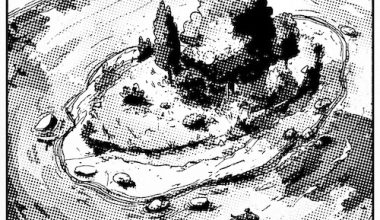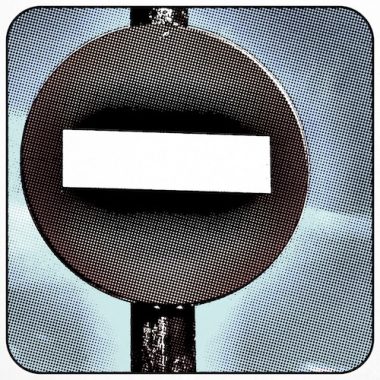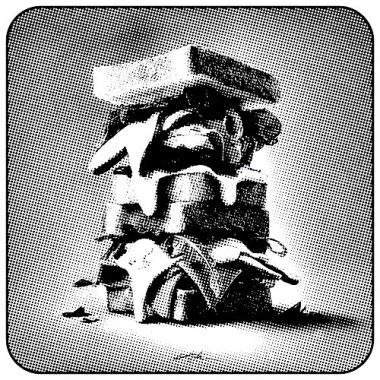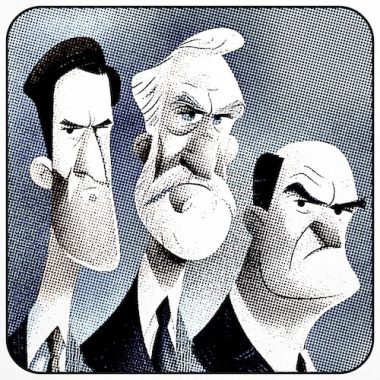Ausgabe #301 | 09. Oktober 2025
Wenn Wählen spaltet
Der griechische Philosoph Platon wird immer wieder gerne von Menschen bemüht, die sich klug geben wollen.
Also auch von Politiker*innen.
Platon zu zitieren, gilt als schick. Sogar unser Bundeskanzler Friedrich Merz bezieht sich in seinem Buch „Mehr Kapitalismus wagen“ ausdrücklich auf Platon.
Und das ist problematisch.
Entweder hat unser Bundeskanzler Platon nicht gelesen. Oder er hat ihn nicht verstanden. Oder noch schlimmer: Er hat ihn gelesen und verstanden.
Wäre das so, dann müssten wir sehr besorgt sein.
Denn Platon hielt von der Demokratie so ziemlich gar nichts. Für ihn war sie die zweitschlechteste aller Gesellschaftsformen.
Seine ideale Gesellschaft dagegen hatte feste Klassen und eine nicht gewählte Regierung von Menschen, denen Ausbildung und Klugheit das Recht zu regieren gab.
Er nannte sie Philosophenherrschaft.
Für Platon war Demokratie dagegen die Herrschaft der Unterschicht. Und das war ein Gedanke, den er nicht ertragen konnte.
Wahlen waren für Platon kein Menschenrecht, sondern ein Risiko, ein Auslöser von Instabilität.
Es ist verständlich, dass politische Eliten diese Einschätzung nachvollziehen können.
Deshalb ist es wichtig, dass wir darüber sprechen.
Denn die einzige Legitimation von Herrschaft in einer Demokratie ist die Wahl. Wenn aber die an die Macht gekommenen Herrschenden grundsätzlich mit dieser Legitimationsform hadern, kann Demokratie schnell erodieren.
Wir erleben in den USA gerade im Zeitraffer-Tempo, wie Demokratien sterben, wenn Wahlen von signifikanten Teilen der politischen Elite als taktisches Instrument und nicht mehr zentrale Legitimationsgrundlage betrachtet werden.
Im Zertifikatslehrgang „Beteiligungsmanagement“, dessen vierter Durchgang gerade läuft, fangen wir deshalb ganz bewusst mit Platon an.
Denn sein Denken beeinflusst unsere Demokratie bis heute. Es spukt auch in den Köpfen mancher Bürger*innen, denen die zeitraubenden, konfliktreichen Prozesse der Demokratie auf die Nerven gehen.
Den Staat nicht als gemeinsames Projekt zu begreifen, sondern als Dienstleister, der vor allem die Infrastruktur am Laufen zu halten hat – auch das ist von einem platonischen Staatsverständnis geprägt.
Sich ernsthaft mit Beteiligung zu beschäftigen, beutetet deshalb auch: Platons Kritik an der Demokratie ebenso zu verstehen wie die von ihm erdachten Alternativen.
Denn die Stärke der Demokratie ist es eben, dass sie es den Regierenden nicht leicht macht.
Den Regierten aber auch nicht.
Während Platon vor allem einen statischen Staat wollte (und viele ihm da folgen) ist es die Aufgabe der Demokratie, das Gegenteil zu organisieren: Eine fortwährende Veränderung.
Und da sind Wahlen eben wichtig.
Doch sie sind kein Universalwerkzeug. Es braucht auch den Diskurs. Und der kommt in unserer Demokratie gerade zu kurz.
Das ist einer der Gründe für den Aufschwung der Beteiligung. Sie setzt auf dialogische Formate, auf den direkten Austausch von Menschen mit unterschiedlichen Werten, Haltungen, Wissensständen.
Das Herz der Demokratie bleibt die Wahl. Beteiligung kann sie nicht ersetzen. Sie sollte sie auch nicht kopieren. Denn Wahlen ohne Diskurs können spalten, wie Geschichte und Gegenwart immer wieder zeigen.
Deshalb wird in Beteiligungsprozessen diskutiert und nur in Ausnahmefällen abgestimmt.
Und wenn, dann erfolgen solche Abstimmungen eher als Meinungsbilder, um den Diskurs Schritt für Schritt zielführender zu gestalten – nicht um die Debatte zu beenden.
Aus diesem Grund setzen Beteiligende auch weniger auf Ja/Nein-Abstimmungen, sondern auf sogenannten Sozialwahl-Konzepte.
Das Systemische Konsensieren ist so ein Verfahren.
Hier werden zunächst gemeinsam mehrere alternative Möglichkeiten formuliert, diese stehen dann ebenso zur Wahl wie die Variante „Alles bleibt so, wie es ist.“
Die Abstimmenden vergeben nun 0 bis 10 Punkte für jede Option. Allerdings genau andersherum als üblich. Die Punkte sind Widerstandspunkte. 0 Punkte heißt „Super, ich bin dabei“. 10 Punkte bedeuten „Das will ich überhaupt nicht“.
Am Ende „gewinnt“ die Option mit den wenigsten Punkten. Es ist nicht jene, die die meisten wollen. Sondern jene, die die geringste Ablehnung erzeugt.
Das Ergebnis ist kein Konsens, aber es ist so konsensnah wie möglich.
Das Berlin Institut für Partizipation bietet Seminare zu diesen und anderen Sozialwahl-Verfahren an. Es gibt sogar Online-Tools, mit denen eine solche Abstimmung blitzschnell realisiert werden kann.
Probieren Sie es mal aus – es lohnt sich.
Das Systemische Konsensieren kann Diskurse nicht ersetzen.
Aber dabei helfen, sie zielführend zu gestalten, statt zu spalten.
Genau das ist die Aufgabe von Beteiligung.