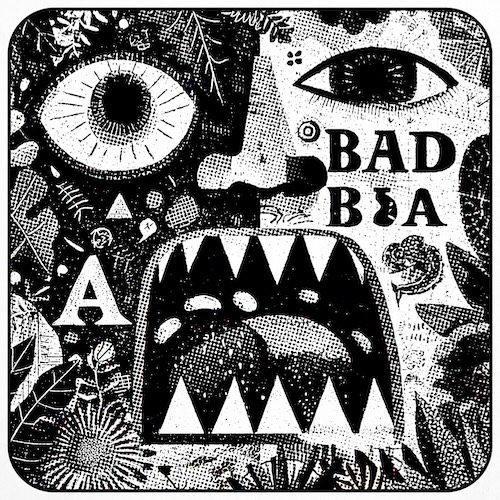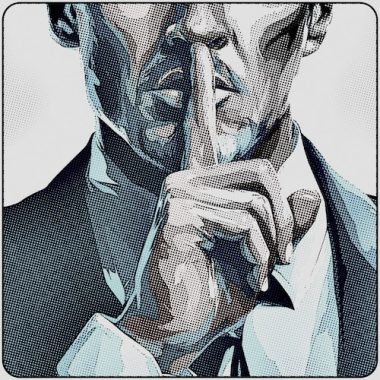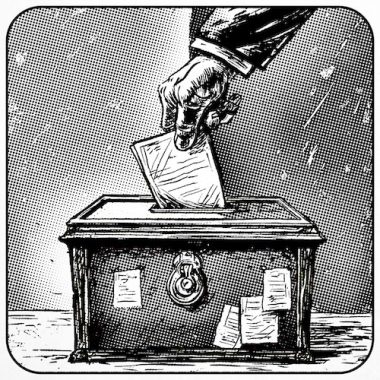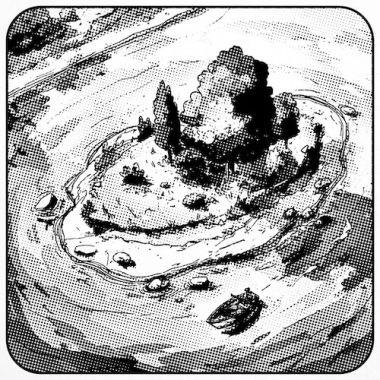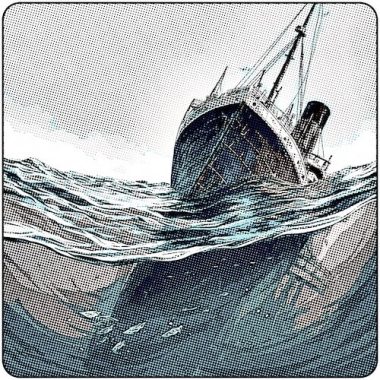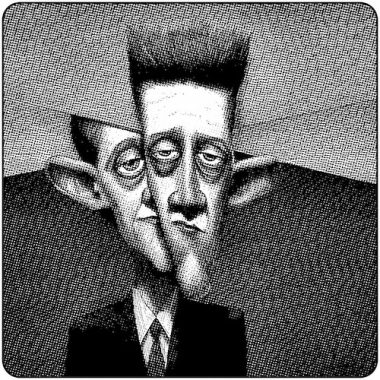Ausgabe #304 | 30. Oktober 2025
Böse Wörter
Den Namen Tom Marvolo Riddle kennen nur wenige.
Obwohl er eine ganz außergewöhnliche Rolle in einem der größten Literaturphänomene der letzten 50 Jahre spielt. Viel bekannter ist er unter seinem selbstgewählten Pseudonym:
Lord Voldemort.
Oops. Jetzt ist es heraus. Ich hoffe sehr, dass mich der Fluch nun nicht treffen wird. Denn Harry Potter Fans wissen, dass der Name niemals ausgesprochen werden darf.
Im Harry-Potter-Universum wird er aus Angst deshalb auch „Du-weißt-schon-wer“ oder „Der-dessen-Name-nicht-genannt-werden-darf“ genannt.
Ein klassisches Tabu.
Sogenannte Sprachtabus gibt es viele. Ohne, dass es rechtlich oder anderweitig verbindlich fixiert ist, gelten bestimmte Wörter in bestimmten Kontexten als nicht sagbar.
Das ist oft sinnvoll. Weil damit zum Beispiel verhindert werden soll, dass bestimmte Personengruppen stigmatisiert werden – oder weil es Codes zum Beispiel für faschistischen Terror sind.
Man schreibt unter einen Social Media Posts zu Bürgergeldempfänger*innen nicht „Arbeit macht frei.“ Weil es an dunkelste Zeiten erinnert.
Man bestellt heute auch kein Zigeunerschnitzel mehr, kauft keinen Mohrenkopf und nennt die indigene Bevölkerung der USA nicht mehr Indianer.
Dass über die Sinnhaftigkeit solcher Tabus gestritten wird, gehört dazu. Denn dabei geht es um Werte und Haltungen. Und die sind eben oft sehr unterschiedlich.
Manchmal sind es deshalb auch höchst unterschiedliche Gründe, warum Menschen sich an dasselbe Tabu halten.
Die einen wollen damit signalisieren, dass sie sensibel bezüglich rassistischer Unterdrückung bestimmter Gruppe sind. Die anderen wollen nur keinen Stress. Die dritten praktizieren das Tabu, weil sie sich nicht mit der Problematik auseinandersetzen wollen.
Tabus können alles sein: sinnvoll, nötig, unangemessen und sogar kontraproduktiv.
Auch die Bürgerbeteiligung kennt ein solches Tabu-Wort. Erst am vergangenen Dienstag war es wieder Teil einer spannenden Debatte.
Es stand prominent in einem politischen Antrag, den die Mitglieder des Fachverbands Bürgerbeteiligung beschließen wollten.
Akzeptanz.
Die Reaktionen darauf waren höchst unterschiedlich. Einige lasen darüber hinweg, manche nickten sogar. Viele aber zuckten sichtbar zusammen, als die das Wort in diesem Satz lasen:
„Beteiligung schafft Akzeptanz, auch bei unliebsamen Entscheidungen.“
In der Debatte kamen viele Alternativvorschläge auf den Tisch: den Satz komplett streichen; Akzeptanz durch ein unverfängliches Wort ersetzen; wenigstens das „schaffen“ entschärfen.
Die Debatte war spannend, immer wertschätzend. Die Lösung war eine leichte Entschärfung und Umsortierung.
Am Ende gab es bei den allermeisten Mitglieder Akzeptanz für diese Lösung. Mal klarer, mal mit knirschenden Zähnen.
Der Antrag wurde mit überwältigender Mehrheit beschlossen.
Offensichtlich wurde aber, dass auch in Zukunft viele Beteiliger*innen das Wort Akzeptanz vermeiden werden.
Es hat den Anschein, als sei Akzeptanz im Kontext von Beteiligung etwas Böses, sozusagen der Lord Voldemort der Beteiligung.
Gerade, wenn uns gute Beteiligung wichtig ist, sollten wir über Akzeptanz sprechen.
Sie sollte kein Tabu sein. Denn das Wort verletzt niemanden. Es beschreibt lediglich. Entweder ein Motiv für oder ein Ergebnis von Beteiligung. Und jetzt müssen wir ganz tapfer sein:
Beides ist völlig in Ordnung.
Und auch verbreitete Realität. Ein großer Teil kommunaler Beteiligungsprozesse zu Vorhaben ist von der Hoffnung getragen, am Ende Akzeptanz dafür zu erzielen. Und das ist völlig legitim.
Ist der Beteiligungsprozess gut, kann es auch gelingen.
Akzeptanz kann Motiv und Ergebnis von Beteiligung sein. Ganz besonders von guter Beteiligung.
Entscheidend ist dabei nicht Motiv oder Ergebnis.
Sondern das, was dazwischen passiert.
Beteiligung ist Dialog mit Wirkungsanspruch.
Wird das realisiert, ist der Prozess fair, sind die Informationen nicht manipulativ, gibt es den Willen und die Möglichkeit, ein Vorhaben besser, anders, vielleicht sogar ganz anders zu realisieren – dann leistet Beteiligung genau das, was sie leisten soll.
Und dann ist Akzeptanz für das so diskutierte und ggf. modifizierte Vorhaben genau der Leistungsnachweis gelungener Beteiligung.
Dann gibt es auch keinen Grund, sich um den Begriff herumzudrücken, ihn zu ersetzen durch Toleranz, Einvernehmen oder ein anderes schönes Wort.
Echte Bürgerbeteiligung ist etwas anderes als Akzeptanzkommunikation. Die ist als nicht ergebnisoffene kommunikative Einbahnstraße konzipiert. Und ja, manchmal tarnt sie sich auch als Beteiligung.
Dann ist das Problem aber nicht die erhoffte Akzeptanz. Sondern die simulierte Beteiligung.
Gute Beteiligung verhandelt Konflikte, diskutiert Alternativen, spricht über Akzeptanz.
Und manchmal, wenn der Prozess gut ist, das Vorhaben aber Murks – dann gibt es eben keine Akzeptanz dafür. Und auch das ist dann gut so.
Das ist jedoch kein Grund, den Begriff zu tabuisieren.
Wir sollten über Akzeptanz sprechen.
In jeder Beteiligung.
Immer.