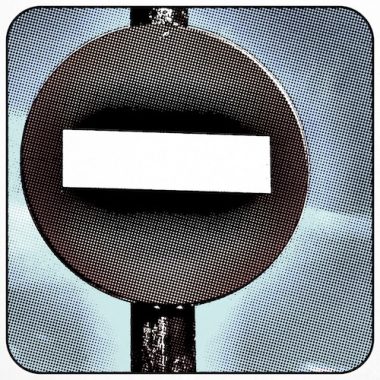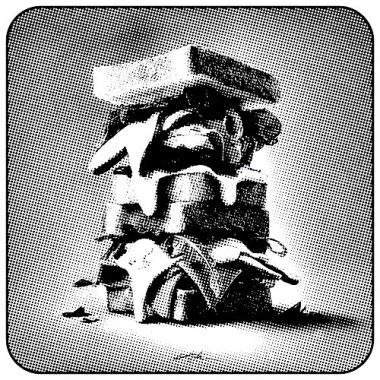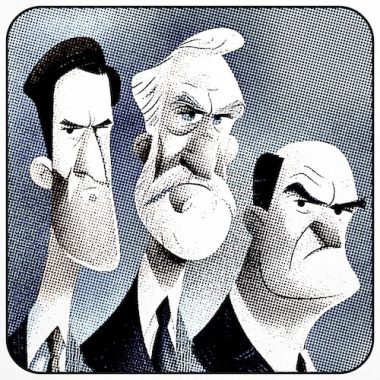Ausgabe #308 | 27. November 2025
Julia Klöckner hat recht
Es war ein Bundestagspräsident der CDU, dem wir den ersten parlamentarisch legitimierten Bürgerrat in Deutschland verdanken.
Wolfgang Schäuble musste seine ganze Autorität einsetzen – und ein paar taktische Kniffe nutzen, um sich das Mandat des Parlaments zu holen. Deshalb schleuste er das Thema damals nahezu überfallartig durch den Ältestenrat.
In den Fraktionen gab es Widerstand. Ganz besonders in seiner eigenen.
Parlamentarier*innen haben in der Regel viel investiert, um schließlich ein Mandat zu erringen. Nur um dann schnell zu lernen, wie begrenzt die Macht einfacher Abgeordneter ist.
Wählerinnen und Wähler, Medien, Lobbygruppen und Parteistrukturen zerren an einem. Alle wollen Einfluss, wollen mitreden.
Da ist die Idee, sich das bisschen Macht auch noch mit weiteren, neuen Strukturen wie Bürgerräten zu teilen, nicht wirklich attraktiv.
Wolfgang Schäuble setzte den ersten Bürgerrat dank seiner Autorität dennoch durch. Auch weil das Thema „Deutschlands Rolle in der Welt“ gewählt wurde – eines, das maximale Konfliktfreiheit garantieren sollte.
In seiner Partei konnte er die Vorbehalte aber nie vollständig ausräumen.
So nutzte es auch wenig, dass dieser erste Bürgerrat unfallfrei über die Bühne ging. Übrigens auch weitgehend wirkungslos.
Ein ähnliches Schicksal widerfuhr dem zweiten Bürgerrat „Ernährung“, diesmal in Regie der Ampel-Koalition. Wieder sauber organisiert, wieder mit weitestgehend einvernehmlichen, durchaus beachtenswerten Ergebnissen, wieder weitgehend ohne Wirkung.
Die Ängste im Parlament? Sie blieben.
Nun hat die aktuelle CDU-geführte Bundesregierung das Thema vorläufig abgeräumt. Die dafür eigens geschaffene Stabsstelle in der Bundestagsverwaltung wird aufgelöst.
Die aktuelle Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, aus derselben Partei wie Wolfgang Schäuble, wird in der Presse mit den Worten zitiert:
Die demokratische Legitimierung des Bundestags sei „um ein Vielfaches größer als es jedes dialogische Beteiligungsformat“ sein könne.
Damit hat sie natürlich recht.
Das Problem ist, dass sie ein paar Dinge verwechselt.
Womit sie nicht alleine steht.
Zunächst einmal haben wir aktuell eine ganz erhebliche Verzerrung, was die mediale Aufmerksamkeit für das Thema Bürgerbeteiligung angeht.
Deutlich weniger als 1 Prozent der Beteiligungsprozesse in Deutschland sind als Bürgerrat aufgesetzt. Betrachtet man die Berichterstattung in den deutschen Leitmedien, sieht das völlig anders aus.
Über ein Drittel der Beiträge zu Bürgerbeteiligung fokussieren sich auf Bürgerräte. Im Verhältnis zur bewährten kommunalen Betroffenenbeteiligung sind sie tatsächlich tausendfach überrepräsentiert.
Diese verzerrte Wahrnehmung haben wir in der Politik genauso wie in Teilen der Zivilgesellschaft. Dort wird oft von einem „Boom“ der Bürgerräte gesprochen. Empirisch ist der nicht nachweisbar.
In der Politik wiederum sind massive Delegitimierungsängste entstanden.
Auch weil zahlreiche zivilgesellschaftliche Akteure eigenständig, ohne öffentlichen Auftrag, Bürgerräte durchführen – und dann nicht selten von der Politik verlangen, die Ergebnisse nun aber gefälligst auch umzusetzen.
Genau das wiederum führt in der Politik zur Einschätzung von Bürgerräten als Kampagneninstrument und dazu, dass Bürgerräte nicht nur abgelehnt, sondern offensiv bekämpft werden.
Das ist schade.
Auch wenn es sich um ein medial oft überhöhtes Format und nur einen Bruchteil der deutschen Beteiligungswirklichkeit handelt, so sind Bürgerräte doch ein ganz hervorragendes Tool der partizipativen Politikberatung.
Solche Formate leistet sich die Politik in vielen Schattierungen zu zahlreichen Themen.
Sie hört auf den Rat für nachhaltige Entwicklung, auf die sogenannten „Wirtschaftsweisen“, sie führt Woche für Woche Verbändeanhörungen durch.
Alles wird als bereichernd wahrgenommen und in den Politikbetrieb integriert.
Doch ein weiteres Format, in dem zufällig ausgewählte ganz normale Bürgerinnen und Bürger ihre Perspektiven einbringen, soll nun plötzlich eine Gefahr für den Parlamentarismus sein?
Das ist schwer zu glauben.
Sollen Bürgerräte eine Zukunft haben, bedarf das Formate der Nachjustierung, ja sogar der Aufwertung – aber auch der Befreiung von überhöhten Erwartungen.
Letztlich ist sogar eine Institutionalisierung denkbar – und sinnvoll. Genau wie bei den erwähnten und bewährten anderen Gremien der Politikberatung.
Eines können Bürgerräte nämlich sehr gut: Bürgerperspektive einbringen und damit als wichtiges Format der partizipativen Politikberatung wirken.
Dazu braucht es Entspannung in der Politik und in der Zivilgesellschaft. Solange Bürgerräte als Kampagnenformat organisiert und wahrgenommen werden, ist eine solche Entspannung nicht realistisch.
Das braucht eine strategische Neuausrichtung in der Zivilgesellschaft, aber auch eine methodische Weiterentwicklung des eigentlichen Formats.
Vor allem aber braucht es eine Erkenntnis in der Politik.
Wenn Julia Klöckner sagt, die demokratische Legitimierung eines gewählten Parlaments sei um ein Vielfaches größer als es jedes dialogische Beteiligungsformat, dann hat sie vollkommen recht.
Wenn sie das als Argument gegen Beteiligung versteht, dann liegt sie komplett falsch.
In der dialogischen Beteiligung geht es eben nicht darum, Entscheidungen eines gewählten Parlaments zu ersetzen, vorwegzunehmen oder zu korrigieren – sondern darum, sie zu qualifizieren und stärker zu legitimieren.
Gute Bürgerbeteiligung bringt die Sichtweise der unmittelbar Betroffenen ein – die in der Regel nicht oder nur marginal in Parlamenten vertreten sind.
Und sie organisiert Dialog zwischen Menschen mit unterschiedlichen Haltungen, Interessen und Kulturen, im Idealfall unter Einbeziehung der Entscheider*innen in Politik und Verwaltung.
In tausenden deutschen Kommunen ist das längst erkannt und dialogische Beteiligung fester Bestandteil kommunaler Kultur.
Liebe Julia Klöckner, es geht nicht um die Legitimierung von Beteiligung, sondern um die Legitimierung durch Beteiligung.
Wenn wir uns die aktuelle Wahrnehmung unserer politischen Akteure in der Bevölkerung anschauen, dann drängt sich der Schluss auf:
Es wäre eine wirklich, wirklich gute Idee, diese Chance zu nutzen …