Ausgabe #79 | 08. Juli 2021
Gefahr aus dem Osten?
Eine „vertiefte Grundskepsis“ bei vielen Ostdeutschen diagnostizierte Marco Wanderwitz, der Ostbeauftragte der Bundesregierung vor wenigen Tagen.
Dass die Ostdeutschen auch 30 Jahre nach der deutschen Einheit noch nicht „in der Demokratie angekommen“ seien, ist ein beliebtes Narrativ, belegt immer wieder durch hohe Wahlergebnisse für die AfD, Querdenker-Hotspots und rassistische Übergriffe.
Westdeutsche (und manche Ostdeutsche) Interpret*innen aus Politik, Medien und Wissenschaft interpretieren Umfragen dazu gerne damit, „dass die Ostdeutschen nicht lernfähig seien und immer noch an der Diktatur hingen.“ Und das, wo es ihnen doch ökonomisch so gut gehe, wie noch nie.
Diese Erklärmuster sind ebenso naheliegend wie falsch. Sie tragen zwar Einiges zum Verständnis der Demokratieskepsis in Ostdeutschland bei, aber anders als beabsichtigt. Sie erklären vor allem, wie sehr unsere Eliten die Situation missverstehen – und warum ihnen keine wirksamen Lösungen einfallen.
Es stimmt: Die Demokratieskepsis in Ostdeutschland ist erheblich höher als in den westdeutschen Bundesländern. Eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach legt das zumindest nahe. Lediglich 42 Prozent der Befragten gaben an, dass die in Deutschland gelebte Demokratie die beste Staatsform sei. In Westdeutschland meinten dies dagegen 77 Prozent der Befragten.
Dass dies eine unmittelbare Folge von DDR-Biografien ist, lässt sich jedoch nicht belegen. Die AfD war bei den kürzlichen Wahlen in Sachsen-Anhalt die mit Abstand stärkste Partei – bei genau jenen jüngeren Wähler*innengruppen, die nach 1989 geboren wurden.
Die angeblich so diktaturgeprägten ehemaligen DDR-Bürger*innen entschieden sich dagegen mehrheitlich für demokratische Parteien.
Es ist also etwas komplizierter.
Entsprechend kurz greifen Programme, die einer vermeintlichen oder tatsächlichen Demokratieferne mit Bildung und/oder Aufklärungsangeboten begegnen wollen.
Demokratie ist keine Wissenskompetenz, sondern eine Kultur. Kultur aber muss gelebt werden, sonst stirbt sie. Spielt sie im Alltag keine Rolle, wäre es blauäugig zu erwarten, dass sie den Menschen in irgendeiner Form am Herzen liegen könnte. Werden Demokratieerlebnisse auf alle paar Jahre stattfindende Wahlentscheidungen kondensiert, mutiert die eigene Stimme vom Selbstwirksamkeitserlebnis zur Denkzettelaktion.
Genau das erleben wir immer wieder, bei jeder einzelnen Wahl. Mit ungebrochener Tendenz.
Es wäre also höchste Zeit, darüber zu streiten, wie wir diese erwähnten demokratischen Selbstwirksamkeitserlebnisse intensivieren, vervielfachen, in den Alltag der Menschen fließen lassen und so den diabolischen Zusammenhang zwischen gefühlter Ohnmacht und unregelmäßiger Denkzetteloption aufzubrechen.
Eine Frage der Bildung ist es offensichtlich nicht, was aber schlägt zum Beispiel der eingangs zitierte Ostbeauftragte der Bundesregierung vor?
Wanderwitz will „in Formaten wie Werkstattgesprächen den Menschen auf Augenhöhe begegnen und ihnen zuhören, den Menschen auch erklären, warum gewisse Dinge nicht funktionieren, so wie sie es sich wünschen.“
Diese Art von Lösungsstrategien sind tatsächlich eher ein Teil des Problems als ein Beitrag zur Lösung.
„Zuhören“ und „Erklären“ offenbaren nicht nur ein zutiefst patronales Verständnis einer Elite, die meint, alles richtig zu machen – es dem Volk nur besser begreiflich machen zu müssen. Es ist zudem ein Angebot, das erst einmal nichts, aber auch gar nichts mit Demokratie zu tun hat. Tatsächlich war es schon das Standardmittel der SED in der bis 1989 existierenden DDR, die ein aufwändiges „Eingabesystem“ mit ausgefeilter Propaganda kombinierte.
Eine positive Beziehung zur Demokratie entsteht nicht, weil man sie erklärt bekommt, oder motzen darf. Ein guter Diskurs ist Voraussetzung für Demokratieaffinität. Aber nur, wenn er auf Augenhöhe stattfindet und vor allem: Wenn er wirksam ist.
Nicht ohne Grund sprechen wir von Selbstwirksamkeitserfahrung, nicht von „Erklärerfahrung“ oder „Zuschauererlebnis“.
Demokratie muss man nicht erklären, sondern erleben, um sie zu lieben – oder zumindest zu respektieren.
Wenn wir unsere Demokratie langfristig stärken wollen, liegt hier der Schlüssel. In mehr, regelmäßiger, alltagsbezogener Beteiligung nicht nur aber ganz besonders für die jüngere Generation. Die Frage, die wir uns stellen sollten, lautet:
Wenn Menschen in Ost oder West unsere Demokratie nicht attraktiv genug finden – vielleicht bieten wir ihnen einfach nur zu wenig davon an?








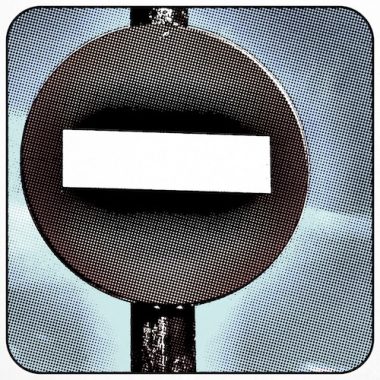
Großartig geschrieben! Ich bin begeistert von der Klarheit und Seriosität der Argumentation. Nur: wie bringt man diese in noch mehr Köpfe? Und das möglichst schnell! Denn solange Feindbilder á la Wanderwitz von so einflussreicher Position aus und auf so scheinbar subtile Art reproduziert werden, kann es doch mit dem Demokratie-Verständnis nicht wirklich besser werden? Denn dann bleiben auch die „Eliten“ ein selbstreproduzierter … witz!
Vielen Dank für die verbalen Blumen. Ja, “ wie bringt man diese in noch mehr Köpfe?“. Eine spannende Frage. Wir beobachten seit einigen Jahren, dass es mehr Dialogangebote gerade auch in den ostdeutschen Bundesländern gibt. Allerdings wird dort noch überwiegend der Dialog zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, allenfalls noch mit beauftragen Moderator*innen organisiert – und das häufig ohne jeden Wirksamkeitsanspruch. Es raucht sicher mehr Dialoge zwischen den politisch Verantwortlichen und Bürger*innen, mehr Prozesse mit tatsächlichem Wirkungspotential, mehr Streit um politische Themen. Mehr Demokratie. Faktisch geht die Zahl unmittelbarer persönlichee positiver Demokratieerfahrungen für viele Menschen auch heute noch immer gegen Null …