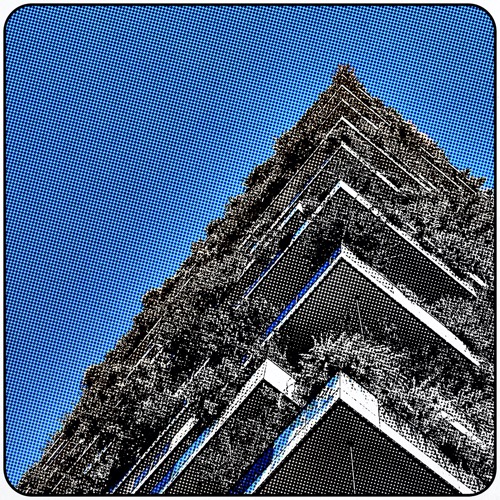Ausgabe #86 | 26. August 2021
Transformation und Partizipation
Demokratie ist dann stark, wenn sie Konflikte gemeinwohlorientiert anpackt, nicht umschifft.
Kommt Ihnen bekannt vor? Ich gebe es zu. Der vorletzte Newsletter endete mit dieser Aussage. Der letzte begann damit.
Ich konnte es also erneut nicht lassen. Denn heute wollen wir über Transformation sprechen. Ein ziemlich verschwurbelter Begriff. Gerade hinreichend inhaltsleer, um in der Politik gerne und ausgiebig zitiert zu werden: Jede*r darf damit etwas anderes meinen.
Erst kürzlich diskutierte ich auf einem Podium schon beinahe 20 Minuten mit einem IHK-Geschäftsführer, bis es dem Moderator schwante, dass wir beide mit Transformation etwas völlig anderes meinten: Ich sprach vom nötigen Umbau unserer Gesellschaft zu einem ökosystemkompatiblen Wirtschaften und Leben. Mein Gegenüber schwärmte von der völligen Digitalisierung der Geschäftsmodelle – genau so wie der oben zitierte Jeff Bezos.
Der Moderator bekam das dann nicht mehr wirklich zusammenmoderiert. Also decken wir den gnädigen Mantel des Schweigens über den Rest der Veranstaltung, die dort gewonnenen Erkenntnisse sind für die Nachwelt belanglos.
Das Folgende basiert deshalb auch nicht auf dieser Debatte, sondern auf einem Vortrag, den ich einige Zeit vorher ausgerechnet vor der Konrad-Adenauer-Stiftung der CDU halten durfte. Dort war auch die anschließende Diskussion erheblich produktiver – einerseits, weil wir uns nicht missverstanden, andererseits, weil wir uns alles andere als einig waren. Und wir wissen ja:
Ein guter Konflikt belebt jede Debatte.
Also: Heute sprechen wir von DER Transformation, vor der alle Gesellschaften und auch unsere Demokratie stehen. Denn die Klima- und Umweltkrise zwingt uns Menschen dazu, den Umbau unserer Gesellschaft hin zu einem konsequent an den Prinzipien der Nachhaltigkeit ausgerichteten Denken und Handeln ernsthaft voranzubringen.
Dass dieser Transformationsprozess ebenso alternativlos wie herausfordernd ist, ist vielen Akteur*innen in der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft klar. In der Wirtschaft hat sich diese Erkenntnis bislang nur zögerlich durchgesetzt, in der Politik bestimmt sie zwar häufig die Sonntagsreden, aber nur in geringem Umfang das gesetzgeberische Handeln.
In großen Teilen der Bevölkerung ist das Bewusstsein dafür, wie tiefgreifend die nötigen Umgestaltungen ausfallen werden, kaum vorhanden.
Ohne dieses Bewusstsein werden die notwendigen Prozesse jedoch – insbesondere in demokratisch verfassten Gesellschaften – von der Politik kaum ernsthaft angestoßen. Geschähe dies wieder aller Erwartungen doch, wären tiefgreifende Verwerfungen und Spaltungen die unmittelbare Folge.
Wie also kann der Transformationsprozess zu einer nachhaltigen Gesellschaft gelingen? Hier gibt es im Grunde drei mögliche Ansätze. Zum ersten neigen unsere politischen, intellektuellen und wirtschaftlichen Eliten, zum zweiten neigen viele Engagierte und zivilgesellschaftliche Organisationen. Der dritte ist der richtige.
Aber fangen wir vorne an: mit dem althergebrachten Top-down-Ansatz.
Unser modernes repräsentativ-parlamentarisches System basiert auf gewählten Volksvertreter*innen. Diese werden mittels eines in bestimmen Zyklen auftretenden Wahlaktes von Bürger*innen legitimiert. Macht ihres Amtes erlassen diese Repräsentant*innen Gesetze und steuern so von oben (Top) gesellschaftliche Reformen, die schließlich die Lebenswirklichkeiten der Bürger*innen beeinflussen.
Politische Teilhabe ist hier ein passives Konzept und beschränkt sich auf einen Akt: Mit einem Wahlmandat geben Bürger*innen Verantwortung an eine politische Elite ab, die innerhalb einer Legislaturperiode in hohem Maße politische Autonomie genießt.
Dieses System steigert die Effizienz und gewährleistet Stabilität. Das Prinzip repräsentativer Demokratie ist weitestgehend unstrittig. Der Vorteil eines solchen Systems ist die relativ große Macht der Regierenden. Sie haben die – theoretische – Möglichkeit, notwendige – wenn auch möglicherweise unpopuläre – Maßnahmen zu beschließen und durchzusetzen.
Das klingt – zumindest theoretisch – dann besonders attraktiv, wenn es um die tiefgreifende Umgestaltung einer Gesellschaft geht – um die eingangs erwähnte Transformation.
Ohne Zweifel können so zum Beispiel dort, wo die Natur im gesellschaftlichen Handeln oder der unternehmerischen Kalkulation häufig das Nachsehen hat, strenge staatliche Regeln helfen.
Ohne ambitionierte Umweltgesetzgebung oder die Subventionierung innovativer, ressourcensparender Technologien könnten die destruktiven Folgen eines ungezügelten Wachstums nicht abgefedert werden.
Allerdings ist diese Form politischer Gestaltung bislang offensichtlich wenig erfolgreich. Letztlich korrespondiert beispielsweise der Höhepunkt des globalen CO2-Ausstoßes ausgerechnet mit dem „Siegeszug“ demokratischer Staaten in den letzten 50 Jahren.
Kaum ein/e gewählte/r Politiker*in traut sich, die nötigen Maßnahmen ernsthaft zu ergreifen. Sie sind zu vielen Lobbyist*innen und Stakeholdern verpflichtet und vor allem haben sie die Wiederwahl fest im Blick.
Würden sie nicht so denken, stünde die politische Karriere schnell auf der Kippe.
Hinzu kommt die zentrale Schwäche der repräsentativen Politik: Die Betroffenen politischer Maßnahmen sollen letztlich erhebliche Einschnitte in ihre Lebensführung akzeptieren, werden aber nicht wirklich gefragt.
Das funktioniert schon mehr schlecht als recht in akuten Krisen wie z. B. der Corona-Pandemie. Dort geht es nur um verhältnismäßig minimale Einschränkungen über einen begrenzten Zeitraum. Das, was die Transformation uns jedoch abverlangt, ist einerseits dauerhaft und andererseits ein Vielfaches mehr, als nur eine Mund-Nasen-Bedeckung in der Öffentlichkeit.
Konsumverhalten, Arbeitsleben, soziale Sicherung, Mobilität – es gibt keinen gesellschaftlichen Bereich, der nicht vollständig neu gedacht und organisiert werden muss. Top-down funktioniert das nicht.
Zumindest nicht in einer Demokratie.
Autoritäre Staaten haben es da leichter. Dort sind die Bürger*innen top-down-konditioniert. Gewaltige Transformationsprozesse könnten in diesen Gemeinwesen erheblich leichter durchgesetzt werden.
Das verführt den einen oder anderen Autoren dazu, die anstehende Transformation als Begründung für ein Ende der Demokratie anzuführen. Das klingt überzeugend, ist aber falsch. Wir brauchen nicht nur keine Ökodiktatur, um die Welt zu retten. Sie würde auch nicht funktionieren.
Zum einen liegt es im Wesen von Diktaturen, dass sie die Partikularinteressen des Diktators (oder selten der Diktatorin) und ihrer engeren Clique als alleinigen Maßstab für das Handeln nehmen. Denen aber ist es herzlich egal, was all denen widerfährt, die nicht über ihre Privilegien verfügen. Gute Diktator*innen gibt es nicht. Und Gemeinwohl ist kein Diktatorenprojekt, sondern Ergebnis von gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen. Diese sind aber in Diktaturen nicht vorgesehen.
Unser vorläufiges Fazit lautet also: Top-down wird das nichts mit der Transformation. Nicht in Demokratien. Nicht in Diktaturen. Überhaupt nicht.
Was also ist mit dem charmanten Gegenentwurf? Dem Bottom-up-Prinzip? Gewissermaßen der Antithese zu Top-down?
Die dialektisch Geschulten unter uns ahnen es bereits: Antithesen klingen überzeugend – so lange, bis man sie genauer prüft.
Das wollen wir tun, am nächsten Donnerstag nehmen wir uns die nötige Zeit dafür.