Ausgabe #223 | 11. April 2024
Der Diktator und die Fahrverbote
Verkehrsberuhigung ist heute überall ein Thema. In nahezu allen Umfragen unter Stadtmenschen rangiert es unter den drei wichtigsten Dingen.
Das ist nicht neu. Ebenso wie die konsequenteste Form der Verkehrsberuhigung: die Fußgängerzone.
Tatsächlich ist sie über 2.000 Jahre alt. Keinem anderen als Julius Cäsar wird nachgesagt, der „Erfinder der Fußgängerzone“ zu sein.
45 v. Chr. war Rom eine Weltstadt. Und das hieß Chaos. Ströme von Fußgängern wälzten sich durch die oft schmalen Straßen.
Sie kämpften mit Tausenden von Ochsenwagen und Pferdegespannen um jeden Zentimeter Platz.
Täglich wurden Menschen überfahren oder zerdrückt.
Breitere Straßen ließen die hügelige Stadt und die dichte Bebauung nicht zu.
Anwohner*innen schimpften, Händler und Lieferanten waren unzufrieden. Es musste eine Lösung her.
Julius Caesar, Diktator und der starke Mann in Rom, musste beweisen, dass er nicht nur Provinzen erobern konnte – sondern eben auch zu Hause für Ordnung sorgen.
Er schaute sich die Sachlage an, konsultierte seine Experten.
Und entschied: Private und gewerbliche Fahrzeuge wurden tagsüber aus der Stadt verbannt. Ausnahmen gab es nur für öffentliche Bauvorhaben, Priesterinnen und Priester sowie für siegreiche Feldherren und deren Triumphzüge.
Eine ebenso einfache wie wirkungsvolle Lösung für das Problem mit der Fußgängerzone.
Dachte Caesar.
Doch er hatte die Interessen und Folgen der Beteiligten nicht bis zum Ende durchdacht.
Jeden Tag warteten draußen vor den Toren der Stadt lange Schlangen von Fuhrwerken. Gingen dann nachts die Tore auf, ratterten sie los. Und verursachten auf den groben Pflastern der Stadt einen höllischen Krach. An Schlaf für die Einwohner*innen war nicht mehr zu denken.
Der nächste Aufruhr war vorprogrammiert.
Was war also schiefgelaufen für den historischen Verkehrsplaner? Er wollte ein Problem lösen. Und schaffte ein Neues. Weil er beim Scoping pfuschte.
Den Begriff kennen wir aus Wirtschaft und Wissenschaft. Im Rahmen von Projekten bedeutet Scoping die Definition von Aufgabeumfängen (Wirtschaft) bzw. Untersuchungsumfängen (Wissenschaft).
Seit 1997 ist ein Scoping in der EU bei Umweltprüfungen vorgeschrieben. Um diese Umweltberichte oder Umweltprüfungen möglichst effektiv durchführen zu können, wird im Scoping der Untersuchungsraum (räumlich) und die Untersuchungstiefe (inhaltlich) zuvor festgelegt.
Auch in Prozessen der politischen Teilhabe sprechen wir von Scoping.
Im sogenannten Beteiligungsscoping geht es darum, bereits vor dem eigentlichen Beteiligungsverfahren einen individuellen Fahrplan für den gesamten Prozess aufzustellen, in dem alle Belange berücksichtigt werden.
Wer wie intensiv wann zu was beteiligt werden soll, ist nicht unwichtig. Es kann die Ergebnisse von Beteiligungsprozessen ganz erheblich beeinflussen, wenn bestimmte betroffene Gruppen „vergessen“ werden.
Oder der Beteiligungsgegenstand unklar ist. Oder gar falsch gewählt.
Deshalb findet gutes Beteiligungsscoping auch nicht am Grünen Tisch statt. Und nicht nur innerhalb der beteiligenden Institution.
In gewisser Hinsicht ist Beteiligungsscoping schon der Beginn der Beteiligung. Denn es findet bereits partizipativ statt.
Umfeld- und Stakeholderanalyse stehen zu Beginn. Sie ergeben einen ersten groben Katalog der Themen, Interessen, Rahmenbedingungen und benennen relevante Akteur*innen.
Und so gut wie immer sind sie unvollständig.
Deshalb sollten in einem zweiten Schritt genau jene Gruppen eingeladen werden, die zuvor ermittelt wurden.
Gemeinsam mit ihnen wird der erste Entwurf kritisch analysiert. Ideen für bislang nicht berücksichtigte Gruppen und Themen werden gesammelt und im Konzept ergänzt.
Manche Beteiliger*innen drehen noch eine dritte Schleife, indem sie die so qualifizierte Analyse öffentlich zur Diskussion stellen, zum Beispiel über ein digitales Beteiligungsportal.
Als erstes Bundesland hat Baden-Württemberg die Durchführung eines Beteiligungsscopings in einer Verwaltungsvorschrift festgelegt.
Der Vorhabenträger soll auf Basis einer Umfeldanalyse Anwohner*innen, Interessengruppen und interessierte Bürger*innen zu einem Beteiligungsscoping einladen. Allerdings entscheidet er am Ende, welche Formate der Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt werden
Nur wenn klar abzusehen ist, dass das Verfahren „unstreitig“ ist, kann auf ein Beteiligungsscoping verzichtet werden.
Gerade bei kleineren Kommunen und Prozessen ist ein aufwändiges dreistufiges Scopingverfahren schnell überdimensioniert.
Was aber als Idee bleibt – und in jedem Beteiligungsprozess sinnvoll ist: Die Pläne mindestens einmal mit potenziell Betroffenen diskutieren.
Erstaunlich oft geschieht das noch nicht. Dabei wäre es so einfach. Und so wirksam.
Denn irgendwas oder irgendwen vergisst man immer.
Schon das Verkehrsplanungsdesaster im alten Rom hätte Julius Cäsar mit ein wenig Scoping vermutlich verhindern können.
Gut, das ist mehr als 2000 Jahre her. Umso weniger gibt es eine Entschuldigung dafür, heute dieselben Unterlassungssünden zu begehen.
Denn heute wissen wir: Scoping macht Beteiligung besser.
Immer.

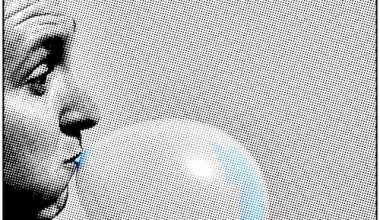







Lieber Herr Sommer,
Vielen Dank für den Artikel über Caesar und die Fußgänger Zone. Danach möchte ich eine bloß Tatsache vorn stellen, bloß aber leider kaum gehört.
Aber zuerst, bitte verzeihen Sie mich für mein schwaches Deutsch und für die vielfältigen Fehler (ich bin französischsprachiger).
In Belgien hat das Institut Vias die Schwelle der tödlichen Geschwindigkeit im Fall eines Stoßes gegen ein Fußgänger gesetzt : 80 km/h (Vias-Vitesse-et-vitesse-exessive.pdf ; auch auf die wallonische Regierung website: https://www.awsr.be/securite-routiere/vitesse/)
Das bedeutet, dass ein Fahrer, der in einer Stadt 80 km/h fährt, mit dem Tod jene Fußgänger auf seinem Weg bedroht und wenn es jemand auf seinem Weg gibt, jemand der wegen des Stoßes stirbt, das ist kein Unfall sondern deutlich Mord.
Im Fall eines tödliches Schoß, so zu Sagen dass es kein Beweis einer Intention zu töten gibt, wenn man in der Stadt über 80 Km/S fährt, ist wie mit einer Waffe in einem Kaufzentrum zu schiessen und sagen dass man nicht jemanden zielt und so keine Intention zu töten hat, nur sein Werkzeug zu benützen willen.
Um zu schießen, gibt es Schießstand, um zu rasen gibt es Rennbahn. Sportwagen und sportliche führen hat nicht auf der Straße zu sein sondern auf einem Rennbahn. Na ja was macht ein Sportwagen auf den öffentlichen Weg? Das ist eine zusätzliche Geschichte.
Herzlichen Glückwunsch
Jipé